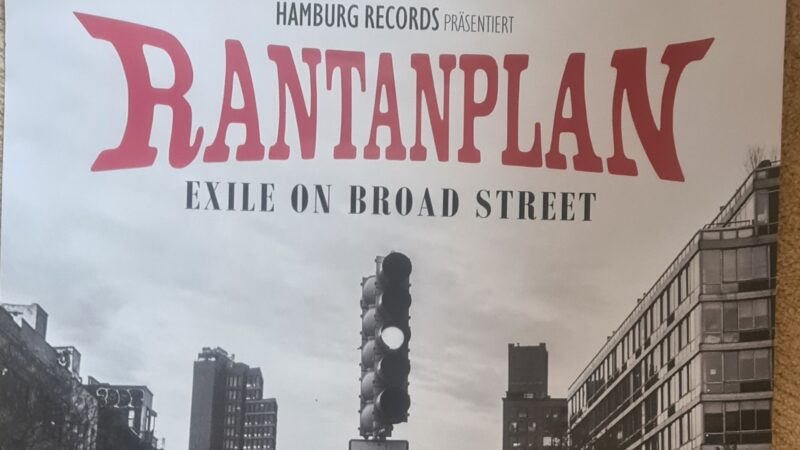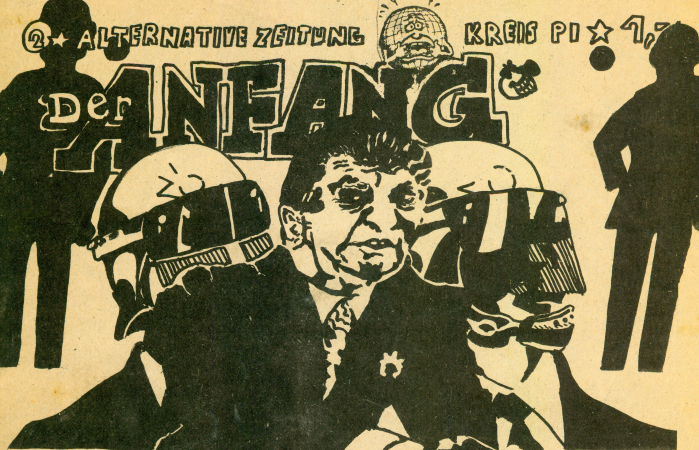Fernwärme-Wende Hamburg: Varianten und Module werden geprüft

Gegen das Klimamonster Moorburg: BUND-Protest zur Inbetriebnahme des Vattenfall-Kraftwerks. Es gab keine Richtungsentscheidung in Sachen künftiger Fernwärmeversorgung in Hamburg und das ist gegenwärtig auch sachgerecht, auch wenn es durchaus dringend ansteht, das marode klima- und umweltschädliche Heizkraftwerk in Wedel zu ersetzen. Für alle Varianten, die derzeit von der Umweltbehörde und im Energienetzbeirat kursieren, fehlt es noch an Vielem. Nicht nur Fragen der Wirtschaftlichkeit sind offen oder wann jeweils welches Modul der vorgesehenen Variante überhaupt realisiert werden könnte. Vor allem aber fehlt es an einer Gesamt-Bewertung, was tatsächlich an CO2-Minderungen am Ende dabei herauskommen wird. Hinzu kommt: Die Südvariante, die derzeit immer wieder genannt wird, birgt ein großes Risiko: Durch die Hintertür könnte Vattenfalls Klimamonster Moorburg in die Fernwärme drängen und das Gegenteil von erneuerbarer Fernwärme zur Folge haben. Die Umweltbehörde hat das heute ausgeschlossen, aber Vorsicht und gründliche Prüfung bleiben erforderlich.
Mehr Informationen und Hintergründe:
- Richtungsentscheidung erneuerbare Fernwärme Hamburg – mit oder ohne Kohle-Moorburg?
- Hamburger Wärme-Klima-Wende: Zoff um Wedel-Ersatz – Moorburg durch die Hintertür?
 Gestern protestierten KlimaschützerInnen vor den Toren in Tiefstack (Foto), wo die Wärme-Hamburg-Gesellschaft über das weitere Vorgehen beriet und dessen Ergebnis heute Umweltsenator Kerstan im Rathaus verkündete. Vattenfall hält an dieser Gesellschaft 75 Prozent, die Stadt Hamburg 25. Künftig soll sie nach dem erfolgreichen Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ vollständig rekommunalisiert werden. Die taz Nord berichtete gestern in diesem Artikel.
Gestern protestierten KlimaschützerInnen vor den Toren in Tiefstack (Foto), wo die Wärme-Hamburg-Gesellschaft über das weitere Vorgehen beriet und dessen Ergebnis heute Umweltsenator Kerstan im Rathaus verkündete. Vattenfall hält an dieser Gesellschaft 75 Prozent, die Stadt Hamburg 25. Künftig soll sie nach dem erfolgreichen Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ vollständig rekommunalisiert werden. Die taz Nord berichtete gestern in diesem Artikel.
Das Abendblatt berichtet jetzt über die heutige PK des Umweltbehörde. Darauf reagiert auch der BUND Hamburg mit dieser Presseerklärung: „Keine Hintertür für Kohlewärme aus Moorburg – BUND Hamburg fordert eine vergleichende CO2-Bilanz der Szenarien für die neue Wärmeversorgung“, die umweltFAIRaendern hier gleich unten dokumentiert.
UPDATE: Die taz.hamburg berichtet über die Pressekonferenz des Umweltsenators unter der Überschrift: „Senat prüft zwei Varianten für Fernwärme – Wärmewende mit Fallstricken. Hamburgs Umweltsenator lässt Szenarien prüfen – ohne das Kohlekraftwerk Moorburg. Sein politisches Schicksal hängt davon ab, ob ihm die Klimaschützer glauben.“
- Auf der heutigen PK der Umweltbehörde wurden zwei Präsentationen vorstellt. Hier die von Hamburg Wasser/Energie (PDF) und hier die von der Stadtreinigung (PDF).
Weiter schreibt Gernod Knödler: „Wie der Senator am Dienstag mitteilte, hat die Gesellschafterversammlung von Vattenfall Wärme Hamburg (VWH) sechs Millionen Euro für die Planung von zwei Szenarien freigegeben. Im Nordszenario käme die Hälfte der Wärme in Spitzenzeiten aus einem Gasheizwerk am Haferweg in Altona-Nord, im Südszenario der Großteil aus Abwärme und erneuerbaren Quellen im Hafen.“
Der Artikel schildert die Komplexität der Aufgabe, die Fernwärme in Hamburg CO2-neutral zu betreiben und kommt dann dazu: „Das Südszenario hat aus Sicht des Hamburger Energietischs, der die Umsetzung des Volksentscheids kritisch begleitet, eine doppelte Schwäche: Zum einen sieht es vor, Wärme aus der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm statt zu den Ölwerken Schindler in die Stadt zu leiten. Die Ölwerke bekämen ihre Fernwärme dann aus Moorburg. Zum anderen ermögliche es netztechnisch eine Durchleitung der Fernwärme aus Moorburg in die Stadt.
Kerstan versicherte: „Das Kraftwerk Moorburg spielt in unseren Szenarien keine Rolle und war auch kein Gegenstand von Diskussionen oder Beschlüssen im Aufsichtsrat.“ „Wenn es einen neuen Senat gibt, ist das nicht das Papier wert, auf dem es gedruckt worden ist“, sagte Gilbert Siegler vom Energietisch. Seien die erneuerbaren Anlagen erst mal gebaut, werde auch ein CDU-FDP Senat diese nicht abreißen, nur damit Vattenfall seine Wärme loswerde, hielt Kerstan dagegen.“
Was in der Darstellung fehlt: Die Zeitschiene, bis wann die jeweiligen Varianten überhaupt realisiert werden können. Kaum jemand geht derzeit davon aus, dass sie – egal welche Variante – vor 2021 am Start sein könnte. Dann aber gibt es einen anderen Senat als den jetzigen, denn 2020 finden die nächsten Bürgerschaftswahlen statt. Die taz zitiert auch den BUND: „Der Umweltverband BUND, der den Volksentscheid unterstützte, sieht drei Möglichkeiten, Moorburg auszuschließen: das Kraftwerk nicht mit der Leitung in die Stadt zu verbinden; langfristige Lieferverträge für erneuerbare Wärme zu schließen oder ein Wärmegesetz, das Kohle in der Fernwärmeerzeugung verbietet. „Wenn die Option Moorburg nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Protest programmiert“, warnte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch. Um die Szenarien bewerten zu können, müsse der Senat jetzt seine Gutachten veröffentlichen und eine genaue CO2-Bilanz vorlegen.“
- Weitere Meldungen zum Thema: Die Grünen äußern sich mit dieser PM, die Umweltbehörde und Jens Kerstan sind hier nachzulesen. Die Linksfraktion in Hamburg äußert sich so. Und natürlich hat auch die CDU-Fraktion was zu sagen.
In seiner Presserklärung von heute schreibt der Umweltverband BUND:
Keine Hintertür für Kohlewärme aus Moorburg
„Die heute verkündete Freigabe von Planungsmitteln für die Einbindung innovativer erneuerbarer Anlagen in das Fernwärmenetzwertet der BUND Hamburg als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Auch das Bekenntnis zu einer „Wärmewende“ im Rahmen der Abschaltung des Kohlekraftwerks Wedel findet die Zustimmung des BUND.
„Wir freuen uns über die klare Aussage von Umweltsenator Kerstan, dass das Kohlekraftwerk Moorburg in den künftigen Wärmeszenarien Hamburgs keine Rolle spielen soll“, so Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des BUND Hamburg. „Wir werden den Umweltsenator beim Wort nehmen und fordern auch Bürgermeister Olaf Scholz auf, sich öffentlich zur Energiewende in der Wärmeversorgung zu bekennen. Das bedeutet insbesondere, einen Anschluss des Kraftwerks Moorburg an das Fernwärmenetz kategorisch auszuschließen“, so Braasch.
Dies sei von besonderer Bedeutung, da in dem derzeit favorisierten „Szenario-Süd“ die Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm (MVR) eine zentrale Rolle spielt. Diese Anlage gehört zu 55 Prozent dem Unternehmen Vattenfall, das gleichzeitig Eigentümer des Kohlekraftwerks Moorburg ist. Die Nutzung von Wärme aus Kohle würde aber den klimapolitisch notwendigen Kohleausstieg bis 2030 konterkarieren.
Bis zur endgültigen Entscheidung über die beste Lösung in der Wärmeversorgung müsse die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) eine vergleichende CO2-Bilanz der diskutierten Szenarien vorlegen sowie alle aktuellen Gutachten öffentlich zugänglich machen.“