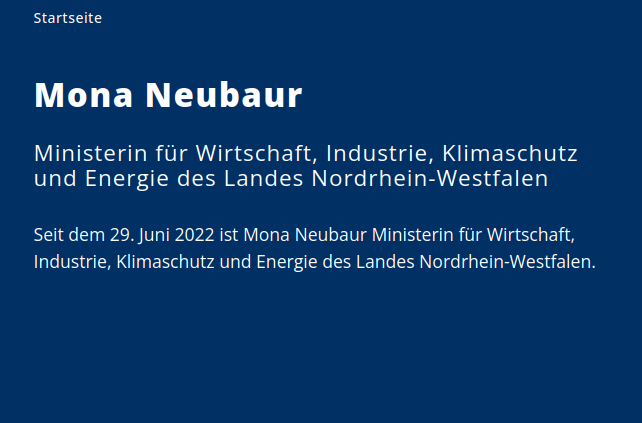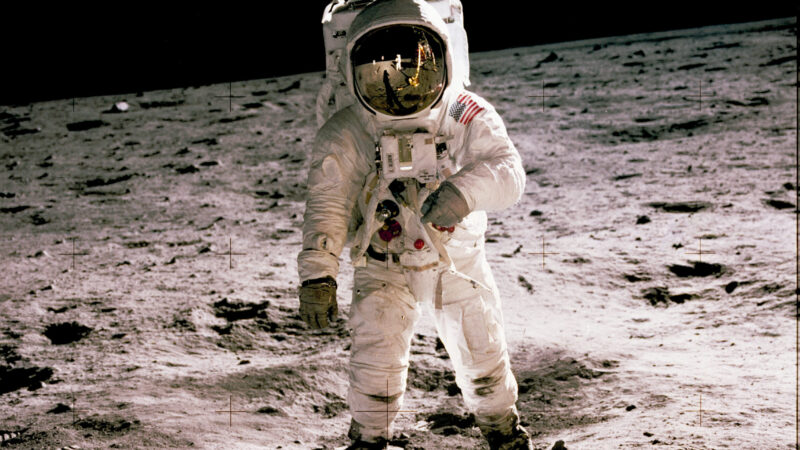BUND und Zukunftsrat Hamburg: Klimaschutz statt Vattenfall – Argumente zum Rückkauf der Fernwärme in Hamburg

Hamburg steht in der Pflicht, die Fernwärme von Vattenfall in diesem Jahr mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zu übernehmen und vollständig zu rekommunalisieren. Das schreibt der verpflichtende Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ vor. Das gilt nicht nur für den rot-grünen Senat, sondern auch für die Bürgerschaft. Dass Vattenfall mit harten Bandagen kämpft, das lukrative Wärmegeschäft zu behalten und sein verlustträchtiges klimaschädliches Kohlekraftwerke Moorburg in die Fernwärme einbringen will, ist nicht verwunderlich, macht aber auch klar: Es geht um gutes Geld beim Geschäft mit der Wärme! Die Leichtfertigkeit, mit der CDU und FDP gegen diese verfassungsmäßige Übernahmeverpflichtung aus dem Volksentscheid an der Seite von Vattenfall streiten, ist erschreckend. Den Kohleausstieg in der Fernwärme bis 2025 strebt die Volksinitiative „Tschüss Kohle“ an. Damit spricht sich die Initiative auch gegen den Fernwärme-Anschluss von Moorburg aus. Zu der aktuellen Debatte zwischen Volksentscheid, finanziellen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wie mehr Klimaschutz in Hamburg ohne Vattenfall möglich wird, haben der BUND Hamburg und der Zukunftsrat jetzt Argumente zum Rückkauf der Fernwärme in Hamburg vorgelegt.
- Vattenfall setzt auf Klimakatastrophe: Moorburg-Kohle statt Erneuerbarer Energien für Fernwärme Hamburg
- Tschüss Kohle: Vattenfalls Klimakatastrophe stößt in Hamburg auf Widerstand
- Was kosten Klimaschutz und Demokratie? Hamburg muss Fernwärme von Vattenfall übernehmen
- Kampfansage: Vattenfall stellt Antrag Kohlekraftwerk Mooburg für Hamburger Fernwärme einzusetzen
Wenn sogar der Konzernchef Tuomo Hatakka selbst nach Hamburg kommt (NDR), dann ist klar: Es geht um viel Geld für Vattenfall in Sachen Fernwärme. Und es geht darum, ob als Ersatz für das Kraftwerk Wedel künftig das Vattenfall-Kohlekraftwerk Moorburg oder ein Konzept zum Umbau mit Erneuerbaren Energien, wie es der Senat anstrebt, zum Tragen kommt. Die Botschaft von Hatakka: Moorburg soll als Übergang dienen. Wenn das Unternehmen von bezahlbaren Preisen für die Kunden redet, dann meint es vor allem die eigenen wirtschaftlichen Interessen. Der BUND Hamburg spricht von einem „vergifteten Friedensangebot“ und bringt die absurde Botschaft von Hatakka auf den Punkt:
„Vattenfall kommt mit einem vergifteten Friedensangebot aus Stockholm. Es bleibt widersinnig, Klimaschutz und Kohleausstieg zu bekräftigen und gleichzeitig in Hamburg Investitionen in Millionenhöhe für eine Fernwärme-Leitung auf den Weg zu bringen, damit das derzeit offenbar unrentable Kohlekraftwerk Moorburg noch möglichst lange läuft.
Bürgermeister Tschentscher steht jetzt vor seiner ersten großen Bewährungsprobe: Er darf den Schweden nicht auf den Leim gehen und muss den Volksentscheid UNSER HAMBURG – UNSER NETZ konsequent umsetzen. Das heißt, auch das Fernwärmenetz vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen und eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien auf den Weg zu bringen“, so Manfred Braasch, Geschäftsführer des Umweltverbands.
Was kosten Klimaschutz und Demokratie? Hamburg muss Fernwärme von Vattenfall übernehmen
UmweltFAIRaendern.de dokumentiert ein Papier, das der Zukunftsrat und der BUND Hamburg jetzt vorgelegt haben, in dem beide Organisationen Argumente aufzeigen, warum und wie die Fernwärme in die öffentliche Hand muss (hier ist der Text auch als PDF):
„Aktuelle Argumente zum Rückkauf der Fernwärme in Hamburg
Bis Ende 2018 soll der Rückkauf der Fernwärmeversorgung in die öffentliche Hand erfolgen – so sieht es der Volksentscheid UNSER HAMBURG – UNSER NETZ vor. Derzeit wird wiederholt in der Öffentlichkeit die Auffassung vertreten, dass – sollte der aktuelle Unternehmenswert der Fernwärme deutlich unterhalb des 2014 vereinbarten Mindestkaufpreises von 950 Mio. Euro liegen ‐ ein Rückkauf trotz bindender Wirkung des Volksentscheids nicht erfolgen könne. Dies sehen Zukunftsrat Hamburg und BUND Hamburg anders.
Der Hamburger Senat hat bisher zwei Ansätze für den Rückkauf des Fernwärmenetzes offenbar nicht in den Blick genommen und ausreichend geprüft: Erstens die kartellrechtliche Anfechtung des überhöhten Mindestkaufpreises für die Fernwärme als „Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung“, welcher verboten ist. Zweitens die Anwendung der in der Landeshaushaltsordnung (LHO) gebotenen Pflicht, bei öffentlichen Investitionen die gesamtgesellschaftlichen monetären und nicht monetären Kosten und Nutzen abzuwägen.
Für einen Rückkauf der Fernwärme sprechen vor allem klima‐ und energiepolitische Aspekte. Eine Energiewende mit der erforderlichen CO2‐Einsparung wird nur gelingen, wenn nicht das betriebswirtschaftliche Interesse von Vattenfall sondern das Allgemeinwohl maßgeblich ist.
Dazu im Einzelnen:
‐ Fernwärmeversorger sind in ihrem Versorgungsgebiet marktbeherrschende Unternehmen, die der kartellrechtlichen Kontrolle nach dem (Bundes‐)Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) unterliegen. Das GWB verlangt „angemessene“ Fernwärmepreise, in die die Kosten für das Netz und die Erzeugungsanlagen eingehen. Die Vereinbarung und Forderung eines überhöhten Mindestpreises für den Netzkauf kann deswegen einen „Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung“ darstellen. Das ist der Fall, wenn später ein erheblich niedrigerer Netzwert als der Mindestpreis ermittelt wird. Der feste Mindestpreis in der „Vereinbarung Wärme“ zwischen der Stadt und Vattenfall wäre dann unwirksam; der Preis muss neu verhandelt bzw. durch ein geeigneten Bewertungsverfahren ermittelt werden. Alle anderen Regelungen der Vereinbarung Wärme bleiben aber bestehen („Salvatorische Klausel“).
‐ Sollte die Rechtsprüfung nach dem GWB jedoch ergeben, dass der vereinbarte Mindestpreis keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, steht auch die Landeshaushaltsordnung (LHO) einer Übernahme des Fernwärmenetzes in die öffentliche Hand nicht entgegen: Zwar muss der Senat bei der Entscheidung über den Kauf eines Fernwärmenetzes die eng unternehmensbezogenen Bewertungen berücksichtigen, wie sie die „Vereinbarung Wärme“ vorsieht. Er muss darüber hinaus jedoch auch nach den langfristigen Kosten fragen, die durch den Verzicht auf eine Übernahme entstünden
– von entgangenen Erträgen über unterbliebene Synergieeffekte (mit der Strom‐ und Gasversorgung) bis zu erhöhten möglichen CO2‐Abgaben im Zuge der geplanten Klimaschutzmaßnahmen.
‐ Nach § 7 Abs.2 LHO ist bei jeder finanzerheblichen Maßnahme eine Nutzen‐Kosten‐Untersuchung (NKU) vorzunehmen. Neben der betriebswirtschaftlichen Analyse sind auch die nicht monetarisierbaren („intangiblen“) Kosten und Nutzen darzustellen und zu bewerten. Die Einhaltung eines Volksentscheids mit politischer Zielsetzung (Klimaschutz und Energiewende) ist ein solcher nicht monetarisierbarer Nutzen. Der Leitfaden der Finanzbehörde zu Kosten‐Nutzen‐Analysen (2005) sagt ausdrücklich: „Bei … einem besonderen Gewicht der intangiblen Effekte kann das mit Hilfe der Kosten‐Nutzen‐Analyse ermittelte betriebswirtschaftliche Ergebnis sogar eine untergeordnete Rolle spielen und nur einen geringen Einfluss auf die Entscheidung haben.“
‐ Die Stadt kann das Fernwärmenetz zunächst auch nur unter Vorbehalt zum Mindestpreis übernehmen, um danach gerichtlich klären zu lassen, welcher Preis angemessen war, und den überzahlten Betrag dann zurückfordern. Diesen Weg sind die „Stromrebellen Schönau“ erfolgreich gegangen.
‐ Die LHO verbot im Übrigen auch nicht die Garantien für die HSH Nordbank, die finanzielle „Lösung“ des Konflikts beim Bau der Elbphilharmonie oder die riskante Übernahme weiterer Unternehmensanteile von Hapag Lloyd 2012. Immer ging es um „die Interessen der Stadt“ (Finanzsenator Tschentscher 2012). Die LHO‐Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verbieten weder die Abwehr von größeren Risiken noch die Wahrung des öffentlichen Interesses und die Erfüllung gesetzlicher, vertraglicher und Volksentscheids‐Verpflichtungen.
‐ Der Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze bindet Senat und Bürgerschaft, siehe Art.50 Abs.4a Landesverfassung. Erst im September 2017 haben sich alle Bürgerschaftsfraktionen bis auf die CDU zu einem Rückkauf der Fernwärme eindeutig bekannt (Drs. 21/10233). Dort heißt es: „Der Senat wird die Call‐Option zum Rückkauf der verbleibenden 74,9 Prozent zum 31.12.2018 ausüben und somit den Übergang des Fernwärmesystems in öffentliche Hand vollziehen.“ (Hinweis umweltFAIRaendern: Zu dem Antrag siehe auch hier: Unser Hamburg – Unser Netz: Senat rekommunalisiert Fernwärmeversorgung)
‐ „Verbindliches Ziel“ des Volksentscheids UNSER HAMBURG – UNSER NETZ ist eine „klimaverträgliche Energieversorgung aus erneuerbaren Energien“. Die Nachhaltigkeitsziele der UN von 2015 („Agenda 2030“), deren Umsetzung sich der Senat ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hat (Drs. 21/9700), unterstützen dies: Ziel 7.2 fordert eine „deutliche Erhöhung“ des Anteils erneuerbarer Energie am globalen Energiemix bis 2030. Ziel 13 fordert „umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels“ und verweist auf die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Nur mit der Übernahme auch des Fernwärmenetzes („Ausübung der Call‐Option Wärme“ im November 2018) ist Hamburg in der Lage, die politischen Weichen für die geforderte Energiewende zu stellen. Eine Wärme‐Einspeisung aus dem Kohlekraftwerk Moorburg würde diese Zielsetzung konterkarieren.
‐ Das Fernwärmesystem der VWH versorgt statistisch jede fünfte Wohnung in Hamburg. Damit wird die Fernwärme zu einem zentralen Instrument, den Gebäudebestand bis 2050 nahezu klimaneutral zu entwickeln. Dieses Ziel der Bundesregierung ist auch in Hamburg umzusetzen. Ein verstärkter Einsatz erneuerbarer Wärme im Hamburger Fernwärmenetz bietet den Vorteil, dass bei einem Teil des Gebäudebestandes auf eine schwierige und teure Dämmung verzichtet werden kann. Der jetzige Betreiber Vattenfall setzt aktuell weiterhin auf Kohlewärme und blockiert den Einstieg in erneuerbare Wärme.
‐ Die kommunale Übernahme des Strom‐ und Gasnetzes ist bereits erfolgreich umgesetzt. Die Übernahme auch der Fernwärme in die Öffentliche Hand bietet die Chance, dass die Stadt betriebswirtschaftliche Synergien aus dem Betreiben aller drei Energienetze nutzt und damit attraktive Konditionen für die jeweiligen Kunden ermöglicht.
‐ Für die weitere Umsetzung der Energiewende sind eine sektorenübergreifend abgestimmte Entwicklung und die Verbesserung von Speichermöglichkeiten entscheidend. Mit dem Zugriff auf das Strom‐ und Gasnetz sowie die Fernwärmeversorgung mit ihren Erzeugungskapazitäten (KWK und zukünftig EE‐ Wärme) kann diese Herausforderung sehr viel besser koordiniert und gemeistert werden. Dies gilt z. B. für die Entwicklung von power‐to‐gas‐Kapazitäten.“
Hamburg, 26. April 2018
www.bund‐hamburg.de www.zukunftsrat.de