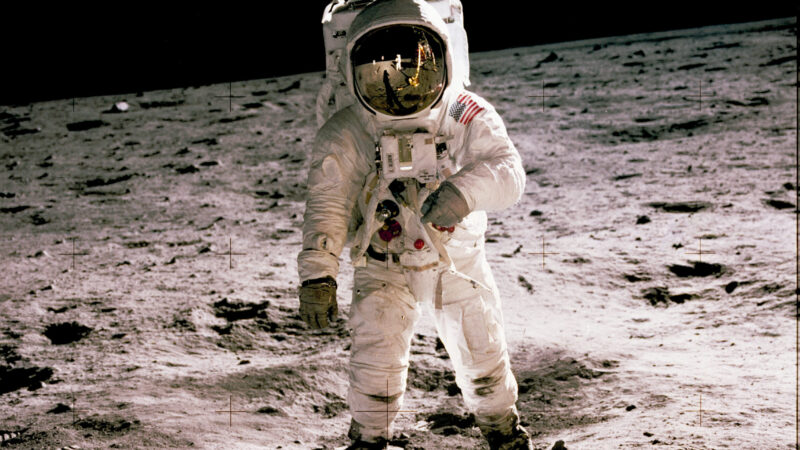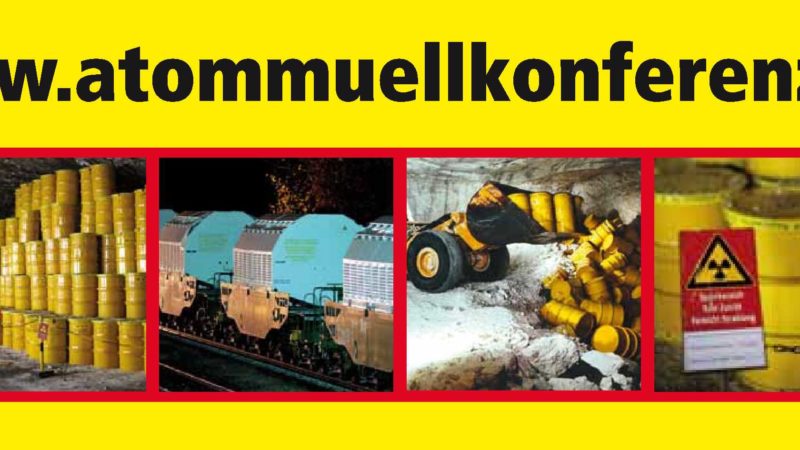10 Jahre Volksentscheid Unser Hamburg Unser Netz – Aspekte der Vorgeschichte der Initiative für die Rekommunaliserung der Energienetze

Zwischenstand Teil 1 – Dirk Seifert: Aspekte einer Vorgeschichte zum Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“: Wachsende Klimarisiken, der Ausverkauf öffentlichen Vermögens und staatlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Um die Bedeutung des Volksentscheids „Unser Hamburg – Unser Netz“ und die massiven politischen Kontroversen, die es zwischen 2010 und 2013 in den einzelnen Schritten von der Volksinitiative (2010) über das Begehren (2011) bis zum Entscheid (2013) zu verstehen, ist es sinnvoll, sich noch einmal die „2000-Jahre“ zu vergegenwärtigen. Geprägt sind diese Jahre seit der Jahrtausendwende von einer massiven Politik des Ausverkaufs öffentlicher Unternehmen, den sogenannten Privatisierungen. In der Energiepolitik sind Atom-Gefahren und Klimakatastrophe sowie die Energiewende und der Ausbau der Erneuerbaren Energien dominante Themen! Vor allem im Linken Spektrum der sozialen und ökologischen Bewegungen wird von Energiekämpfen gesprochen.
Für Hamburg bedeutsam: Von 2001 bis 2011 stellt nicht mehr – wie fast immer nach dem Zweiten Weltkrieg – die SPD die Senatsmehrheit. Erstmals werden 2001 die Sozialdemokraten in Hamburg abgewählt: Die CDU gewinnt mit Ole von Beust wiederholt die Bürgerschaftswahlen und stellt mit teilweise Reaktionären Partnern wie der Schill-Partei den Bürgermeister. Am Ende folgt sogar von 2008 bis Februar 2011 eine Koalition von CDU und Grünen. Die Grünen spalten sich in der Koalition. Aus dem „Regenbogen“ entsteht später die Linksfraktion.
Privatisierung und Verlust von öffentlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Ab Mitte der 1990er Jahre wird in der EU die sogenannte Liberalisierung der Märkte auf den Weg gebracht (Stichwort Labour, Tony Blair in GB – Schröder/Fischer (Grüne) in Deutschland). Im Energiebereich führte das in den Mitgliedstaaten zu einer verstärkten Welle der Privatisierung. Nicht nur die Energieversorgung war davon betroffen. Auch z.B. die Wasserversorgung, die Abfallentsorgung oder Krankenhäuser, die bislang vor allem staatlich betrieben wurden, gerieten als Folge immer mehr unter Privatisierungsdruck.
Auch in Hamburg zeigt die neue neoliberale Politik direkte Wirkung: Ausgerechnet (?) unter dem sozialdemokratischen Bürgermeister Ortwin Runde wird ab 1997 der Verkauf der Anteile an den Hamburgischen Electricitäts-Werken (HEW) eingeleitet. Seit fast 100 Jahren war die Strom- und Wärmeerzeugung in Hamburg bei den HEW in der Hand von Bürgerschaft und Senat. In zwei weiteren Schritten – auch mit den Stimmen der Grünen – wird die HEW schließlich bis 2002 komplett von der CDU mitsamt der ebenfalls im öffentlichen Besitz befindlichen Hamburger Gaswerken (Hein Gas) privatisiert.
Mit der Privatisierung von HEW an Vattenfall und Hein Gas an E.on wurden nicht nur lukrative Geschäftsfelder aufgegeben. Wichtige energiepolitische Entscheidungen werden nun in den Geschäftszentralen in Stockholm und Essen gemacht. Hamburg hatte alle operativ wichtigen Instrumente für eine Energie-, Klima- und Umweltpolitik im Bereich der Energieerzeugung verscherbelt.
Privatisierungen fanden in den Nuller-Jahren aber nicht nur im Energiesektor statt. Gegen den Willen einer Hamburger Mehrheit verkaufte der CDU-geführte Senat unter Bürgermeister Ole von Beust die öffentlichen Krankenhäuser und machte damit die Gesundheit der Hamburger:innen zum Geschäft für private Konzerne! Einen Volksentscheid mit dem Titel „Gesundheit ist keine Ware“, der sich gegen diese Privatisierung im Jahr 2002 erfolgreich ausgesprochen hatte, wurde von der regierenden CDU gemeinsam mit PRO-(Schill-)Partei und der FDP schlicht ignoriert.
Selbst die Trinkwasserversorgung der Hansestadt wäre mit „Hamburg Wasser“ beinahe an gewinnorientierte Privatunternehmen verkauft worden, wenn nicht im letzten Moment die Bürgerschaft am 24. November 2004 nach einem Volksbegehren „Unser Wasser Hamburg“ die Verkaufspläne gestoppt hätte.
Die 2000er Jahre waren aber nicht nur von einer dogmatischen und ideologisch ausgerichteten liberalen Wirtschaftspolitik gekennzeichnet, in der ehemals gemeinwohl-orientierte staatliche Aufgabenbereiche, die sogenannte Daseinsvorsorge, wie Energie, Wasser, Gesundheit zum Gegenstand einer an Profiten orientierten Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik wurden. Mit dem Verkauf an private Investoren verloren demokratisch legitimierte und kontrollierte öffentliche Institutionen wie Regierung und Parlamente immer mehr an konkreten Einflussmöglichkeiten.
Klimakatastrophe und Atomgefahren: Vattenfall und E.on blockieren Erneuerbare Energien
Ein zweites wichtiges und bis heute umstrittenes Handlungsfeld spitzte sich seit den 2000er Jahren weiter zu: Immer klarer wurden die Risiken einer drohenden Klimakatastrophe. Die nukleare Katastrophe von Tschernobyl war unvergessen, Hamburg war bis in die 2000er Jahre von vier riskanten Atomkraftwerken in Stade, Brunsbüttel, Brokdorf und Krümmel umgeben und bedroht. Die Probleme mit dem Atommüll (bis heute) völlig ungelöst. Gorleben und die Castortransporte ins Wendland waren ein Symbol, das Atomenergie gegen eine breite gesellschaftliche Mehrheit nur mit Polizeigewalt durchgesetzt werden könnte. Und schließlich brannte direkt hinter dem Reaktor in Krümmel ein Transformator, Rauch drang in die zentrale Schaltwarte ein. Monatelang versuchte Vattenfall den Vorfall runter zu spielen.
Die erste rot-grüne Bundesregierung hatte Anfang der 2000er Jahre den schrittweisen Atomausstieg im „Konsens“ mit den Atomkonzernen verabredet und parallel die intensive gesetzliche Förderung der Erneuerbaren Energien beschlossen. Mit dem EEG sollten die Markteinführung der Wind- und Solarenergie angetrieben werden und damit die Kosten durch Massenproduktion deutlich unter die Preise von Kohlestrom und Atomenergie gedrückt werden. Je mehr Windturbinen und Solarpanels, desto geringer die Kosten. Das funktionierte, sogar viel besser als Optimist:innen damals erwartet hatten. Aber die dezentralen Erneuerbaren passten nicht in das zentralisierte Giga-Watt-Geschäftsmodel von Vattenfall und Co!
Statt einer solchen Politik zu Folgen und in den Ausbau der Erneuerbaren Energie einzusteigen, forcierten die großen Konzerne vor allem den Ausbau von Kohlekraftwerken. Während die Alarmmeldungen zur Klimaentwicklung nicht mehr zu ignorieren waren und die Förderung der Erneuerbaren Energie zu einem Aufschwung von Wind- und Solaranlagen führten, planten die großen Energiekonzerne bundesweit neue Kohlekraftwerke! Absurd!
In Hamburg setzte Vattenfall ab Anfang der 2000er Jahre den Neubau eines Kohlekraftwerks in Moorburg auf die Tagesordnung. Teile der Politik und Wirtschaft sorgten sogar dafür, dass statt der von Vattenfall geplanten 800 MW schließlich sogar eine Verdoppelung auf 1.600 MW vorgesehen wurde. Am Ende musste in der schwarz-grünen Koalition sogar eine grüne Senatorin entgegen vorherigen Aussagen im Wahlkampf, die Genehmigung für das Kohlekraftwerk in Moorburg unterschreiben.
Heute wissen wir, was für ein gigantischer wirtschaftlicher und klimapolitischer Unsinn dieses Vorgehen war. Als längst absehbar war, dass Moorburg sich zu einem wirtschaftlichen Desaster für Vattenfall entwickeln würde und immer neue Verzögerungen die Inbetriebnahme verschoben, sprach der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz – damals Bürgermeister in Hamburg – im Jahr 2013 sogar noch davon, dass das klimaschädliche Kohlemonster „hochlukrativ“ wäre. (https://umweltfairaendern.de/2013/07/24/vattenfall-500-millionen-euro-verlust-durch-kohlekraftwerk-moorburg-buergermeister-scholz-findet-das-hochlukrativ/)
Weitere Rolle Rückwärts: CDU/CSU und FDP für den Ausstieg aus dem Atomausstieg
Während die politischen Führungskreise zur Freude neoliberaler Wirtschaftsfreunde in Hamburg die HEW verscherbelten und (nicht nur) mit Moorburg weiter Kurs in die Klimakatastrophe hielten, formierte sich gegen den Atomausstiegs-Konsens der rot-grünen Bundesregierung ab Mitte der 2000er Jahre eine politische Front von CDU/CSU und FDP, die eine nukleare Laufzeitverlängerung anstrebte, also den Ausstieg aus dem Ausstieg. Im September 2009 gewannen diese konservativen und neoliberalen Privatisierer die Bundestagswahlen und planten die Laufzeitverlängerung der damals noch 17 in Betrieb befindlichen Atommeiler, davon mit Krümmel, Brunsbüttel und Brokdorf drei AKWs mit Beteiligung von Vattenfall und E.on. (Das AKW Stade war bereits Anfang der 2000er Jahre stillgelegt worden.)
In der Folge kommt es ab Herbst 2009 zu einer der größten Protestwellen der Anti-Atom-Bewegung. 50.000 demonstrierten zunächst in Berlin für den Atomausstieg. Im April 2010 kommt es dann mit 120.000 Menschen zu einer Menschenkette entlang der Strecke von 120 Kilometern zwischen den Vattenfall-AKWs von Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen über das AKW Brokdorf, Hamburg bis zum AKW Krümmel hinter Geesthacht. Zigtausende protestieren mit weiteren Großdemonstrationen oder mit auch zivilen Widerstand gegen Atommülltransporte nach Gorleben. Dennoch: Im Herbst 2010 genehmigt die Regierung Merkel den gefährlichen Atommeilern eine Laufzeitverlängerung von 8 bis 14 Jahren. Doch die Proteste reißen nicht ab.
Als im Frühjahr 2011 in Fukushima mehrere Atomreaktoren nach Erdbeben und Tsunami explodieren demonstrieren gerade zigtausende in Stuttgart anläßlich der dortigen Landtagswahlen mit einer weiteren Menschenkette. In der Folge kommt es zu Demonstrationen überall in der Republik – Merkel rudert zurück. Fast die Hälfte der AKWs wird nach einem Moratorium sofort stillgelegt, dazu gehören im Norden auch die Vattenfall-Reaktoren Schrottreaktoren Brunsbüttel und Krümmel.
Eingebettet in diese Kulisse von regionalen und bundesweiten Auseinandersetzungen in Sachen Atomgefahren, Klimakatastrophe und einer in der EU forcierten Politik des „Raubtierkapitalismus“, wie ein Modewort der 2000er Jahre lautete, geht in Hamburg die Volksinitiative „Unser Hamburg Unser Netz“ im Sommer 2010 an den Start. Das Volksbegehren findet im Sommer 2011 statt, wenige Monate, nachdem in Fukushima mehrere Atomreaktoren explodierten und nach zehn Jahren erstmals wieder ein sozialdemokratischer Bürgermeister gewählt wurde. Doch nicht mit, sondern gegen die SPD muss „Unser Hamburg – Unser Netz“ die Rekommunalisierung durchsetzen.
Am 22. September stimmt eine Mehrheit der Hamburger:innen gegen das Votum von SPD-Bürgermeister Scholz, gegen das Votum der SPD-Fraktion unter Andreas Dressel, gegen die CDU und die FDP und große Teile der Handelskammer und der Hamburger Groß-Wirtschaft den Volksentscheid! Die Privatisierung wird zurück genommen. Hamburg hat wieder starke Energieunternehmen in eigener Hand und kann damit Energiewende und Klimaschutz wieder selbst steuern. Mit demokratischer Kontrolle!