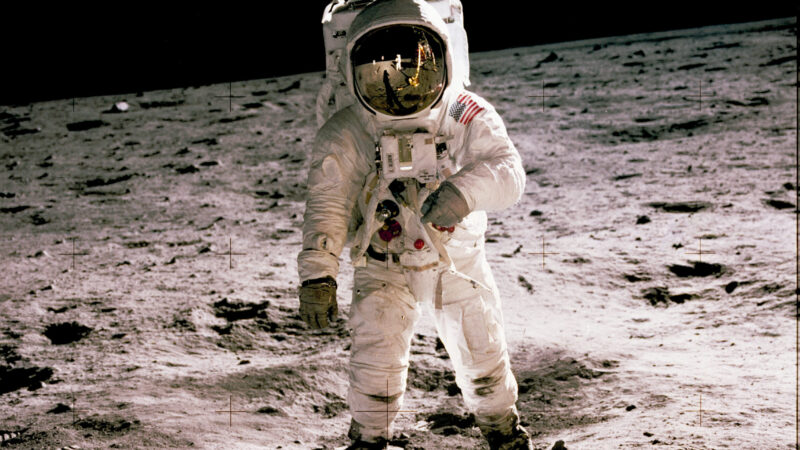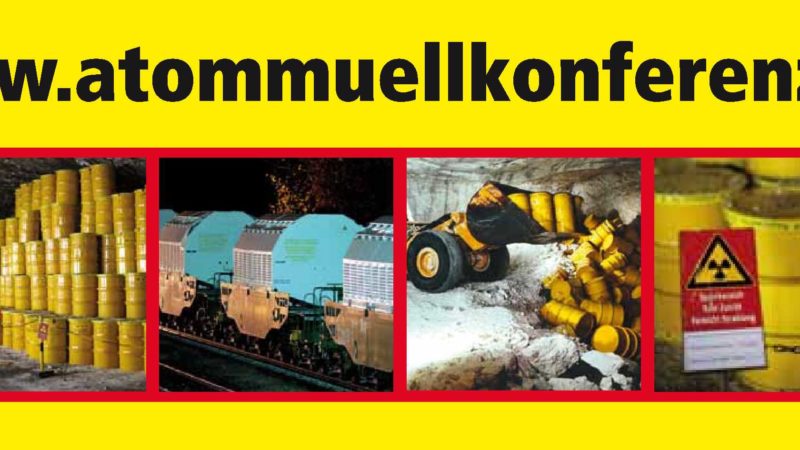Tschernobyl – 39 Jahre nach der Atom-Katastrophe

Am 26. April 1986, um 1:23 Uhr nachts, ereignete sich im Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion (heute Ukraine) eine der schwersten „zivilen“ Atomkatastrophen der Geschichte. Ein fehlgeschlagener Sicherheitstest führte zur Explosion des Reaktors und einem anschließenden Graphitbrand. Große Mengen radioaktiver Stoffe wurden freigesetzt – eine radioaktive Wolke breitete sich über Europa aus. Heute, 39 Jahre später, sind die Spuren des Unglücks noch immer sichtbar – in der Region um den Reaktor, in der Umwelt, in den Körpern der Betroffenen – und inzwischen auch im militärischen Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
- Siehe auch Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BaSE) zur Tschernobyl-Katastrophe und
- Bundeszentrale für politische Bildung: 1986: Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
- Alles zum Thema Atomkatastrophe Tschernobyl auf umweltFAIRaendern.de
- Siehe auch die internationale Ärzt*innen-Organisation IPPNW zu den Hintergründen mit Bezug auf Tschernobyl. 25 Jahre nach der Katastrophe haben die Mediziner*innen in dieser Studie Zwischenbilanz gezogen (PDF)
- Atomkatastrophe Fukushima auf umweltFAIRaendern.de
Die unmittelbaren Folgen waren katastrophal. Zwei Kraftwerksmitarbeiter starben direkt durch die Explosion, 28 weitere Menschen – vor allem Feuerwehrleute – starben innerhalb von Wochen an akuter Strahlenkrankheit. Rund 600.000 sogenannte „Liquidatoren“ wurden zur Eindämmung der Katastrophe eingesetzt, viele ohne ausreichenden Schutz. Die internationale Staatengemeinschaft, darunter auch die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO), ging später von mehreren Tausend strahlenbedingten Todesfällen aus, während unabhängige Studien teils von bis zu 90.000 ausgehen (Greenpeace: „The Chernobyl Catastrophe: Consequences on Human Health“, 2006) oder möglicherweise auch viel mehr.
- Siehe Tschernobyl auch hier bei .ausgestrahlt.
- Siehe zu Tschernobyl auch wikipedia.
- Siehe dazu auch dies beim BUND.
Die radioaktive Wolke, die sich durch Wind und Regen in unberechenbarer Weise verteilte, machte nicht an Grenzen halt. Neben der Ukraine, Belarus und Russland waren insbesondere Polen, Schweden, Österreich und Süddeutschland betroffen. In Bayern wurden nach dem Reaktorunfall Cäsium-137-Werte von bis zu 200.000 Becquerel pro Quadratmeter gemessen4. Noch heute sind Wildschweine aus dem Bayerischen Wald oder der Rhön häufig über dem zulässigen Grenzwert belastet (Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Messwerte nach Tschernobyl und BfS: Aktuelle Daten zur Radioaktivität in Wildschweinen, 2024).
Die Stadt Pripyat, wenige Kilometer vom Reaktor entfernt, wurde evakuiert – zu spät, wie sich zeigte: Die Bevölkerung war bereits erheblich verstrahlt worden. Insgesamt mussten rund 350.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Eine 30-Kilometer-Sperrzone besteht bis heute. Trotz touristischer Führungen bleibt das Gebiet schwer kontaminiert.
Heute, 2025, ist Tschernobyl nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch Teil eines aktuellen militärischen Konflikts. Im Februar 2022, zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, besetzten russische Truppen das Gebiet des stillgelegten Kraftwerks. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde und ukrainischer Behörden gruben sich Soldaten in der besonders stark kontaminierten „Roten Zone“ ein – ohne ausreichenden Schutz. Der Verdacht: Die Besatzer wussten nichts von der Strahlengefahr oder ignorierten sie. Nach rund fünf Wochen zogen sich die Truppen wieder zurück, offenbar mit ersten Krankheitsfällen unter den Soldaten. Im Zuge der Kriegshandlungen wurde auch der erst vor wenigen Jahren neu errichtete Schutzschild aus einer Stahlhülle schwer beschädigt. Zwar ist bislang wohl keine erhöhte Radioaktivität ausgetreten, aber die Integrität der Hülle soll nicht mehr intakt sein.
Auch andere nukleare Standorte in der Ukraine, wie das AKW Saporischschja, gerieten in den Fokus des Krieges. Die IAEO warnt regelmäßig vor den Gefahren einer nuklearen Eskalation durch militärische Angriffe oder technische Störungen unter Kriegsbedingungen.
- Über Saporischschja auf umweltFAIRaendern.de
Tschernobyl bleibt eine Mahnung. Die Lehre von 1986 ist heute aktueller denn je: Atomkraft kennt keine sicheren Grenzen – weder technisch, noch politisch, noch geografisch. Tschernobyl war und ist einer der Meilensteine und Gründe, die zum Atomausstieg in Deutschland führten.