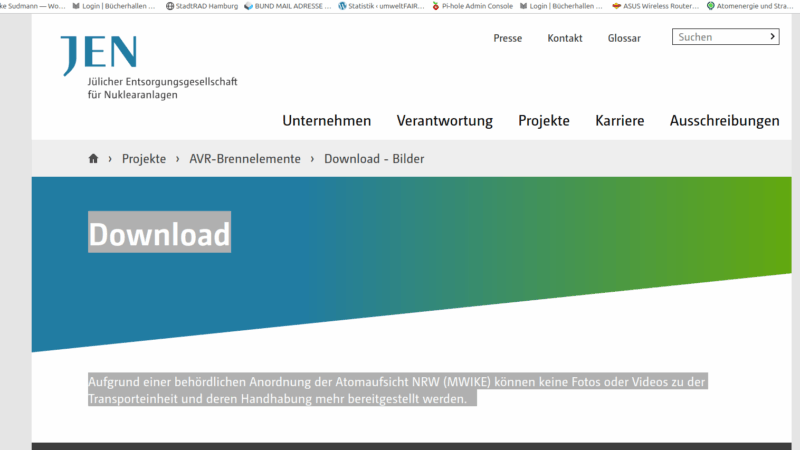Atommülllager: Bayern findet Gorleben bietet sich in besonderer Weise an

Für die Bayern ist klar: Gorleben liegt in Niedersachsen und damit weit genug weg, damit dort auch nach dem neuen Endlager-Such-Verfahren der hochradioaktive Atommüll verbuddelt werden kann. Für den niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel hingegen ist klar: Gorleben ist zwar nach wie vor Teil des Verfahrens – zusammen mit allen anderen Orten der Republik: „Aber ich bin mir sicher, dass dieser Standort ausscheidet, wenn es tatsächlich ein ergebnisoffenes, transparentes und wissenschaftsbasiertes Verfahren gibt.“
- Atommülllager-Suche geht uns alle an: Über 20 Millionen betroffene BürgerInnen
- Hochradioaktiver Atommüll: „Endlagerung“ ohne Bayern und Sachsen?
- Sondervotum: Bayern erklärt Bayern für ungeeignet bei der Atommüll-Endlager-Suche
„Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen bietet sich nach Ansicht von Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) nach wie vor in besonderer Weise für ein Atommüllendlager an“, schreibt die Frankenpost und weiter ist dort zu lesen: „«Wenn man Gorleben in Augenschein nimmt, wird man feststellen, dass die Investitionen, die für diesen Standort schon getätigt worden sind, aus meiner Sicht nicht umsonst getätigt wurden. Man hat hier eine Gesteinsform vorgefunden, die sich für ein Endlager durchaus eignen würde», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in München. Es sei daher richtig, dass der Standort im Wendland bei der neu gestarteten Suche nach einem Atommüllendlager wieder im Rennen sei.“
- Atommüll-Endlager könnte „den Bevölkerungsrückgang im Fichtelgebirge verstärken“
- Niederbayerische Landräte zur Auswahl eines Endlagerstandorts für Atommüll
Und in der Mainpost heißt es: „Scharf betonte, dass der Neustart der Suche generell eine richtige und wichtige Entscheidung sei: „Ich will auf keinen Fall, dass unsere Zwischenlager schleichend zu Endlagern werden. Und wenn man sich den Zeithorizont anschaut, der notwendig ist um ein solches Endlager zu finden, dann muss man schnell beginnen. Es ist unsere Verantwortung, wir müssen uns jetzt darum kümmern.“
- Atommüll-„Endlager“ in Thüringen? Studie sorgt für Unruhe
- Jenseits von Gorleben: Atommülllager bei Schwerin zwischen Zarrentin und Bützow?
Dagegen kritisierte Scharf aber erneut, dass bei der bundesweiten Suche die drei potenziellen Gesteine für ein Lager – Salz, Ton und Granit – als geologische Sicherheitsbarriere für das Endlager nicht gleich behandelt würden. „Man braucht eine gewisse Mächtigkeit von einem Wirtsgestein, um diesen Müll einzulagern“, erläuterte Scharf. Während Salz und Ton als geeignet gälten, werde bei Granit gesagt: „Was da vielleicht nicht zu hundert Prozent eine geologische Barriere darstellen kann, kann ein Behälter im Zweifel lösen.“ Letztlich könnten aber nur geologische Barrieren für Sicherheit sorgen. „Ein Behälter kann da kein Ersatz sein.“
In der Passauer Neue Presse (PNP) kommt niedersachsens Umweltminister zu Wort: „Scharfs niedersächsischer Amtskollege Stefan Wenzel (Grüne) sieht das völlig anders: „Nach der gemeinsamen Beschlussfassung im Bundestag und im Bundesrat steht fest, dass es ein wissenschaftsbasiertes, transparentes und ergebnisoffenes neues Suchverfahren geben wird.“ Die Ausbaumaßnahmen im Salzstock seien beendet, der Rückbau zur reinen Offenhaltung habe begonnen. „Wenn es ein faires Suchverfahren gibt, ist Gorleben aus dem Rennen. Weitere Querschüsse aus Bayern sind für die Umsetzung des Standortauswahlgesetzes nicht dienlich.““
Die PNP berichtet weiter: „Der insbesondere aus Niedersachsen oft verlautende Vorwurf, ausgerechnet das Atomland Bayern entziehe sich bei der Endlagersuche seiner Verantwortung, ist laut Scharf nicht gerechtfertigt. „Wir sind die größten Produzenten, ja, aber uns geht es wirklich um die Sicherheit, nicht um politisches Geplänkel.“ Zuletzt hatte auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) der CSU vorgeworfen, die Endlagersuche zu behindern. Auch der Freistaat wolle den Standort finden, der durch die geologische Barriere die höchste Sicherheit gewährleiste, sagte Scharf. „Aber wir kennen auch unsere Geologie in Bayern. Wir wissen ganz genau, wie wir aufgestellt sind. Deshalb wissen wir auch, dass das Granit bei uns sehr zerklüftet ist.““
Detailliert widmete sich Stefan Wenzel in seiner Regierungserklärung dem Thema „Standortauswahlgesetz und Neubeginn bei der Endlagersuche“, die gleich im Anschluss vollständig dokumentiert wird. Dabei geht er auf das nunmehr beschlossene Standortauswahlgesetz ausführlich ein, zeichnet aber auch die Geschichte des Atomkonflikts in Eckdaten nach und nennt aktuelle Probleme, über die Endlagersuche hinaus: Z.B. die wachsenden Probleme bei der Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle und die Anforderungen an die Castor-Behälter, in denen der Atommüll vermutlich deutlich länger als die bislang vorgesehenen 40 Jahre aufbewahrt werden wird.
-Es gilt das gesprochene Wort-
Anrede,
Bundestag und Bundesrat haben das so genannte Standortauswahl-Gesetz vor wenigen Tagen mit großer Mehrheit verabschiedet.
Einige meinen, damit sei das Thema abgehakt. Zwei Jahre in Berlin diskutiert – beschlossen und fertig.
Anrede,
ein fundamentaler Irrtum, der an die Frühzeit der Asse erinnert. Aus den Augen aus dem Sinn! Das passt gut in diesen Tagen: Vor 50 Jahren wurde der erste Atommüll in die Asse-Schächte bei Salzgitter gekippt.
Die Asse sollte „Sicherheit gewährleisten für alle Zeiten“ und ein Wassereinbruch wurde mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen“. Das Problem Atommüllentsorgung schien gelöst. Bis zuletzt behauptete die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dass sich Risse im Salz von allein schließen. Aber da floss das Wasser schon mehr als zwei Jahrzehnte und ließ sich bis heute nicht stoppen.
Wohlgemerkt: Wir sprechen in diesem Zusammenhang nur über wenige Jahrzehnte.
Beim Standortauswahlgesetz geht es aber um deutlich mehr:
Wir sprechen über tausende Tonnen hoch radioaktiven Atommüll, über unvorstellbare Zeiträume und weit mehr als 100 Milliarden Euro.
Über manches Problem, das uns in diesen Tagen beschäftigt, werden unsere Nachfahren in den intergalaktischen Landesmuseen einer fernen Zukunft kein Sterbenswörtchen mehr finden.
Der Atommüll und seine sichere Lagerung dagegen wird dann todsicher immer noch ein Thema sein.
Anrede,
Das Gesetz regelt das Verfahren zur Suche nach einem Standort für die dauerhaft sichere Lagerung hoch radioaktiver und weiterer schwach- und mittel radioaktiver Abfälle in Deutschland. Dieser Ort soll die bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum von einer Million Jahren gewährleisten.
Diese Entscheidung für einen Neubeginn ist von historischer Bedeutung – gerade auch für Niedersachsen.
Die Geschichte der Atomenergie in der Bundesrepublik Deutschland kann in drei Phasen eingeteilt werden:
Phase 1: Die Zeit der Sorglosigkeit und der Gleichgültigkeit – insbesondere in Bezug auf Gefahren, Halbwertzeiten und die Probleme mit dem Müll.
Phase 2: Die Zeit der Rücksichtslosigkeit – insbesondere im Durchsetzen der Interessen der Atomwirtschaft und im Umgang mit der Zivilgesellschaft.
Phase 3: Darum geht es heute. Die Zeit der Verantwortlichkeit für den Schutz der Bevölkerung und sehr viele künftige Generationen.
Anrede,
es gibt nunmehr die Chance, einen Jahrzehnte währenden gesellschaftlichen Großkonflikt hinter uns zu lassen. Mit dem Gesetz soll ein ergebnisoffenes, transparentes und wissenschaftsbasiertes neues Suchverfahren beginnen.
Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfälle
Die Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe wurde von Bundestag und Bundesrat eingesetzt und nahm im Mai 2014 ihre Arbeit auf. Neben den beiden Vorsitzenden gehörten ihr Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen, der Wissenschaft, des Bundestages und der Landesregierungen an. Nach zweieinhalbjähriger Arbeit legte die Kommission ihren Abschlussbericht vor, der mit großer Mehrheit und nur einer Gegenstimme beschlossen wurde. Der Bericht enthält Empfehlungen und Kriterien für die Auswahl eines Endlagerstandortes in Deutschland, der insbesondere für hoch radioaktive Abfallstoffe bestmögliche Sicherheit gewährleistet und in einem fairen und transparenten Verfahren mit umfassender Bürgerbeteiligung auszuwählen ist.
Die Ergebnisse der Kommissionsarbeit und der Gesetzesnovellen
Niedersachsen hat sich intensiv an der Kommissionsarbeit und der Gesetzesberatung beteiligt und in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgewirkt. Niedersächsische Positionen finden sich in weiten Teilen des Berichts und des Gesetzes.
Als Schwerpunkte sind zu nennen:
Als Konsequenz aus Fehlern der Vergangenheit wurden neue Formen der Bürgerbeteiligung entwickelt, die u.a. einen Rat der Regionen, Fachkonferenzen sowie ein nationales Begleitgremium mit Akteneinsichtsrechten und wissenschaftlicher Begleitung vorsehen.
Die Rechtsschutzmöglichkeiten wurden deutlich erweitert – eine Klagemöglichkeit besteht auch in Bezug auf die Entscheidung zur Festlegung der zu erkundenden Standorte.
Die Neuausrichtung der Endlagerforschung wird im Bericht eingefordert. Die Neuausrichtung wurde beschlossen, bspw. mit Fokus auf Tonstein und Kristallin, Transdisziplinarität und sozio-technische Fragen,
Alle in Frage kommenden Wirtsgesteine Salz, Ton und Kristallin werden berücksichtigt. Mindestanforderungen schließen das Wirtsgestein Kristallin nicht mehr aus. Erneute Versuche, Kristallin als Endlagergestein von Beginn an auszuscheiden, konnten abgewehrt werden. Es war ausdrücklicher Wille der Atommüllkommission, dass alle potenziellen Wirtsgesteine gleichermaßen betrachtet und untersucht werden sollen.
Fehlerkorrekturen und Rücksprungmöglichkeiten wurden verankert, um ein lernendes Verfahren zu ermöglichen. Dabei wurde als Konsequenz aus dem Asse-Skandal der Aspekt der Rückholbarkeit und der Bergungsmöglichkeit für bereits eingelagerten Atommüll gesetzlich verankert. Vorgesehen ist die Möglichkeit einer Rückholbarkeit für die Dauer der Betriebsphase des Endlagers, die Möglichkeit einer Bergung für 500 Jahre nach dem geplanten Verschluss des Endlagers und die Umkehrbarkeit von Entscheidungen im Auswahlverfahren.
Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsuntersuchungen werden neu geregelt. Die Verordnungen hierzu müssen vor Beginn des Verfahrens vorliegen.
Die Verankerung von Kriterien und Anforderungen zur Beurteilung sicherheitsrelevanter Eigenschaften erfolgt auch anhand von Kriterien zur Temperaturverträglichkeit und zum Deckgebirge.
Die Bereitstellung von Daten durch Landesbergbehörden kann einschließlich der Daten Dritter erfolgen. Die Dokumentation und dauerhafte Speicherung von Daten für die End- und Zwischenlagerung ist vorgesehen.
Bereits im Sommer 2016 wurde einerechtliche Umsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Organisationsstruktur für die Endlagersuche vorgenommen.
Dabei wurde auch die Berufung des gesetzlich vorgesehenen nationalen Begleitgremiums unmittelbar nach Abschluss der Kommissionsarbeit unter Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Töpfer und Frau Professor Schreurs verankert. Erstmals erfolgte die Einbeziehung von zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger, die in das Gremium berufen wurden. Das Gremium hat seine Arbeit bereits aufgenommen, wird seine Rolle intensiv wahrnehmen und ist damit auch ein wichtiges Element für ein „lernendes Verfahren“.
Auch das Auslaufen der Veränderungssperre für Gorleben wurde beschlossen. Damit ist endlich die von der Kommission geforderte Gleichbehandlung aller potenziell für ein Endlager geeigneten Standorte möglich. Differenzierte Sicherungsvorschriften sehen vor, dass potenzielle Endlagerstandorte nicht vorzeitig durch Bohrungen und Bodenabbauvorhaben zerstört werden dürfen. Das notwendige Einvernehmen des Bundesamtes für Entsorgungssicherheit (BfE), das der Bundestag noch eingefügt hat, stellt eine einheitliche Handhabung der Vorschrift in Deutschland sicher.
Es wird zudem keine weiteren Castor-Transporte nach Gorleben geben. Der Rückbau für die reine Offenhaltung des Bergwerks hat begonnen.
Handlungsbedarf nach Verabschiedung des Gesetzes
Das neue Gesetz hat viele neue Eckpfeiler gesetzt. Das war aber nur der Anfang. Ich will daher einige zentrale Aufgaben benennen, die jetzt anstehen.
Eine zentrale Herausforderung liegt in den sehr langen Zeiträumen, für die Sicherheit garantiert werden muss. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass wir es nicht allein mit einer technischen Fragestellung zu tun haben. Der Souverän sind die Bürgerin und der Bürger. Von zentraler Bedeutung sind daher Beteiligungsfragen und sozio-ökonomische Fragestellungen. Wir müssen Wissen und Erfahrung an viele nachfolgende Generationen weitergeben. Wir müssen aber auch Kontinuität herstellen. In Kanada studiert man daher im Zusammenhang mit der Endlagersuche, wie die indigene Bevölkerung ihr traditionelles Wissen bewahrt hat und wie sie Wissen und Erfahrung von Generation zu Generation weitergegeben hat.
Zeitplan
Nach Verabschiedung des Gesetzentwurfes muss der Vorhabenträger zügig mit der obertägigen Erkundung starten. Dazu braucht er allerdings eine möglichst vollständige geologische Datengrundlage.
Die Zeitvorgaben sind dabei mehr als ehrgeizig. Sie entfalten keine rechtliche Verbindlichkeit, sind aber Orientierungsrahmen und Aufforderung, mit den notwendigen Arbeiten unverzüglich zu beginnen. Niedersachsen hat bei der Verabschiedung im Bundesrat nochmal deutlich gemacht, dass Zweifel an der Realisierung des Zeitplans bestehen. Andere Nationen nehmen sich teilweise sehr viel mehr Zeit für den gesamten Prozess.
Die Zeitvorgaben dürfen in keinem Fall zur Reduzierung der Sorgfalt bei der Ermittlung und Bewertung der notwendigen Daten, zum Verzicht bei Fehlerkorrekturen und Rücksprüngen sowie zu weniger Beteiligung der Bürger führen. Hier liegt meines Erachtens ein Schwachpunkt des Gesetzes, weil eine ehrliche und offene Kommunikation Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess und die Vertrauensbildung ist.
Umso mehr gilt es, besonderes Augenmerk auf den zügigen Aufbau der Institutionen für die Endlagersuche zu legen. Der Vorhabenträger, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Hauptsitz in Peine und das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde mit Hauptsitz in Berlin muss dazu schnell mit dem erforderlichen Personal ausgestattet werden.
Es gilt, die Herausforderungen für die Zwischenlagerung und die Behälterentwicklung zu meistern.
Die Genehmigungen für Zwischenlager sind begrenzt. Die ersten laufen Ende der 2030er Jahre aus. Die anderen Genehmigungen folgen Schlag auf Schlag bis Mitte der 2040er Jahre. Auch wenn die optimistische Planung wider Erwarten eintreten sollte, läge das Datum der Inbetriebnahme eines Endlagers jenseits der genehmigten Zwischenlagerzeiten.
Fast alle Länder mit Atomenergienutzung haben ihr Waterloo mit „Top Down Prozessen“ bei der Endlagersuche erlebt und neu begonnen. Das gilt für die Schweiz, für Kanada, für die USA und für Großbritannien. Nehmen Sie Kanada: Dort rechnet man mit einem mindestens 50 Jahre längeren Zeitbedarf. Auch in der deutschen Kommission gab es an diesem Punkt sehr stark divergierende Auffassungen.
Für die weitere Planung sollte ein Best Case und ein Worst Case untersucht werden. In jedem Fall muss man erkennen, dass die derzeitig genehmigten Zwischenlagerzeiten nicht ausreichen. Wir werden daher Verlängerungen der Zwischenlagerzeiten benötigen oder neue Zwischenlager. Dabei muss man wissen, dass die Anforderungen an eine Verlängerung kaum geringer sind als die Anforderungen an eine Neugenehmigung. Maßstab ist der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik. Zu bedenken ist auch, dass den Standorten damals ein Ende der Zwischenlagerung nach 40 Jahre zugesagt wurde.
Unterscheiden müssen wir dabei zwischen Sicherheit und Sicherung. Das oben Gesagte gilt für Sicherheit. Das Thema Sicherung gegen Einwirkungen Dritter birgt zusätzliche Herausforderungen. Ich erinnere an den Renegade-Voralarm vor wenigen Tagen und die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Schleswig zum Zwischenlager in Brunsbüttel.
Schon jetzt muss Vorsorge dafür getroffen werden, dass Alterungsprozesse an den in den Zwischenlagern befindlichen Lagerbehältern frühzeitig erkannt und vorbeugend behandelt werden. Reparaturkonzepte für Behälter müssen dezentral so weiterentwickelt werden, dass die in Gorleben befindliche Pilotkonditionierungsanlage endgültig überflüssig wird und abgerissen werden kann. Die Zwischenlager dürfen nicht zu faktischen Endlagern werden. Daher muss der mögliche Abtransport der Lagerbehälter an einen anderen Ort gewährleistet sein. Erforderliche Zwischenlagerstandorte müssen zukünftig eine gerechte Lastenteilung unter den Bundesländern sicherstellen.
Das sind viele Fachfragen, aber auch viele hochpolitische Fragen, die man nicht so einfach in einem Referat oder einer Abteilung des Bundesumweltministeriums entscheiden kann. Es muss daher geklärt werden, in welchem Kreis die Antworten auf diese Fragen vorbereitet werden. Die Kommission hat seinerzeit drei verschiedene Varianten für die Zwischenlagerung diskutiert. Hier gilt es anzuknüpfen. Wir werden uns um die Zwischenlager intensiv kümmern müssen; die Menschen an den Zwischenlagerstandorten dürfen mit ihren Sorgen nicht allein gelassen werden. Auch deshalb muss das Verfahren jetzt zeitnah gestartet werden.
Behälterentwicklung vorantreiben
Abhängig vom letztendlich zu wählenden Konzept für die Endlagerung sind sehr spezifische Anforderungen an die Endlager-Behälter zu stellen. Das betrifft
– die Möglichkeit der Rückholbarkeit, und der Bergbarkeit,
– die langfristige Beständigkeit,
– die Gasdichtigkeit,
– die Gasproduktion,
– die Korrosionsbeständigkeit,
– den Strahlenschutz,
– die Temperaturleitfähigkeit,
– den Hitzeeintrag
– und viele andere technische Anforderungen.
Die verschiedenen derzeitig verwendeten Behälter waren ursprünglich vorrangig als Transportbehälter vorgesehen. Mittlerweile sind sie als Transport- und Zwischenlagerbehälter eingesetzt. Für die Endlagerung war insbesondere ein Pollux Behälter und ein Umpacken von Brennelementen vorgesehen. Hier bestehen noch erhebliche Anforderungen an Forschung und Entwicklung.
Fragen zur Zwischenlagerung von schwachradioaktivem (LAW) und mittelradioaktivem Abfall (MAW)
Mit der Vorlage des Nationalen Entsorgungsprogramms der Bundesregierung wurde deutlich, dass auch die Planung für schwach- und mittelradioaktiven Abfall überarbeitet werden muss. Erwartet werden etwa 620.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle, die unter die Kategorie LAW „schwachradioaktiv“ und MAW „mittelradioaktiv“ fallen. Für Schacht Konrad sind davon 303.000 Kubikmeter eingeplant. Damit ist die Kapazität von Konrad ausgereizt und wir werden keine Ausweitung zulassen!
Weitere ca. 320.000 Kubikmeter dieser Abfälle müssen bei zukünftigen Endlagerungsplanungen an einem anderen Standort berücksichtigt werden. Sei es am Standort eines künftigen Endlagers für hoch radioaktiven Abfall oder an einem weiteren Standort.
Die Zwischenlagerung dieser Abfälle dauert ebenfalls deutlich länger als bislang geplant. Schacht Konrad sollte ursprünglich bereits Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts in Betrieb gehen. Mittlerweile geht die Bundesregierung von einem Zeitpunkt nicht früher als 2022 aus. Schacht Konrad ist planfestgestellt. Klagen gegen den Standort wurden abgewiesen. Vor der Inbetriebnahme muss der Bund aber noch den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik nachweisen.
Die Sicherheitsanforderungen an die oberirdische Zwischenlagerung sind zur Zeit in der Überarbeitung. Zudem sind die Anforderungen der gesetzlichen Regelungen zu beachten, die mit der Übernahme der Zwischenlagerung durch staatliche Institutionen festgesetzt wurden. Von entscheidender Bedeutung ist die Einhaltung der Produktkontrolle beim Eigentumsübergang, um milliardenschwere Folgekosten für die öffentliche Hand zu verhindern. Die Bundesregierung ist gehalten, endlich den öffentlich-rechtlichen Vertrag zu veröffentlichen, der auf Basis des Gesetzes zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission zur Finanzierung des Kernenergieausstieges verhandelt wird. Überfällig ist auch die Rücknahme der offenen Klageverfahren durch die Energieversorger.
Die Bedeutung dieser Punkte wurde bei unserem Besuch vor wenigen Wochen im Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) in New Mexico deutlich. Weil ein einziges Fass mit radioaktiven Abfällen aufgrund von Fehlern bei der Konditionierung geplatzt ist, entstanden Folgekosten von mehr als 650 Millionen Dollar. Die Kosten des dreijährigen Betriebsausfalls dürften sich ebenfalls auf 600 Millionen Dollar aufsummieren. Das Beispiel zeigt, dass strikte Produktkontrolle nicht nur eine elementare Sicherheitsfrage ist, sondern auch sehr hohe ökonomische Bedeutung haben kann.
Geologische Kompetenz des Landes stärken
Auf Landesebene bedarf es einer weiteren personellen Stärkung der geowissenschaftlichen Kompetenz des Niedersächsischen geologischen Landesdienstes, damit der Endlagersuchprozess des Bundes fachlich eng begleitet und bewertet werden kann. Allein die Bereitstellung von Daten der geologischen Dienste, die Auswertung von Gutachten und alten Bohrkernen und weitere mögliche Nacherhebungen von Daten werden die Länder erheblich fordern. Niedersachsen hat hier durch die jahrzehntelange Vorerfahrung wichtige Kompetenzen einzubringen. Dies gilt es bei der Aktualisierung der Zielvereinbarungen mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zu berücksichtigen.
Niemand sollte darauf hoffen, dass er bei fehlenden Daten aus dem Suchprozess ausgeschlossen wird. Das Gegenteil ist der Fall. Die Verbandsanhörung des Bundestages vom 8. März 2017 hat diesbezüglich noch eine wichtige Ergänzung von § 12 ergeben, die die Bereitstellung von Datenmaterial der geologischen Landesämter für den Vorhabenträger regelt. Die Landesämter sind nunmehr auch verpflichtet, bei ihnen vorliegende, aber nicht in ihrem Eigentum befindliche Daten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Eine Standortsuche, die wirklich alle Landesteile einschließt, setzt eine möglichst umfassende Datengrundlage voraus. Gebiete, über die noch keine ausreichenden Daten vorliegen, dürfen nicht vorzeitig aus dem Verfahren ausgeschlossen werden.
Die Verordnung zu neuen Sicherheitsanforderungen und die Verordnung zu Sicherheitsuntersuchungen müssen noch konkretisiert werden.
Diese beiden Verordnungsermächtigungen sind in ihrer Bedeutung vielfach unterschätzt worden. Die Kommission hat sich lange mit diesen Fragen beschäftigt. Aktuell gibt es keine allgemeine Verordnung über Sicherheitsanforderungen für hoch radioaktive Abfälle. Die bekannten Sicherheitsanforderungen von 2010 haben lediglich Erlasscharakter für eine nachgeordnete Behörde – seinerzeit für einen einzigen Standort. Im Bundesanzeiger sind sie nie veröffentlicht worden.
Auch die Konzeption der Sicherheitsuntersuchungen ist noch ein sehr weites Feld. Hier hat die Kommission einige gute und wichtige Grundlagen gelegt. Es fehlen aber neben der Verordnung die untergesetzlichen Ausgestaltungen. Beide Verordnungen sind von großer Bedeutung, um die Anforderungen für bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre genauer zu definieren und mit Hilfe von Sicherheitsuntersuchungen festzustellen, ob ein ausgewählter Ort und eine ausgewählte Lagermethode dauerhaft Langzeitsicherheit gewährleisten können. Niedersachsen besteht darauf, dass die Bundesländer bei der Erarbeitung dieser Verordnungen zu beteiligen sind. Niedersachsen wird zugleich alle Möglichkeiten nutzen, seine Expertise bei der Erarbeitung der Verordnungsentwürfe einzubringen. Niedersachsen wird weiterhin darauf drängen, dass die Empfehlungen des Kommissionsberichts in den Verordnungen eins zu eins umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für die Methodik der Sicherheitsuntersuchungen.
Die Neuausrichtung der Forschungslandschaft ist in Angriff zu nehmen.
Mit dem Standortauswahlgesetz wurde ein Neustart der Endlagersuche in Deutschland vorgenommen. Diesem muss auch die Endlagerforschung Rechnung tragen. Wie die Endlagerkommission in ihrem Abschlussbericht festhält, ist neben der Forschung für den Vorhabenträger, die Regulierungsbehörde und die im Standortauswahlprozess engagierten gesellschaftlichen Gremien, auch eine Forschung zu fördern, „die auf eine von den Vorgaben des Auswahlverfahrens unabhängige Grundlagenforschung ausgerichtet ist und außerdem der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dient“.
Hierfür bieten sich die niedersächsischen Hochschulen mit ihrer Expertise in herausragender Weise an. Um ein Endlager für hoch radioaktive Abfallstoffe zu realisieren, bedarf es technischer Lösungen, an denen niedersächsische Hochschulen schon lange aktiv forschen.
Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine rein technische Perspektive allein nicht ausreichend ist, um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Vielmehr braucht es einen ganzheitlichen Blick auf das Problem. Anders als in der Vergangenheit müssen Fachleute und Experten neben exzellenten disziplinären, eben auch über inter- und transdisziplinäre Erfahrungen und Kenntnisse verfügen.
In all diesen Fragen wurde mit dem vom Bundes-Bildungsministerium (BMBF) geförderten Verbundforschungsprojekt ENTRIA (Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe: Interdisziplinäre Analysen und Entwicklung von Bewertungsgrundlagen) unter Leitung der TU Clausthal seit 2013 erfolgreich Neuland betreten und es wurden Kompetenzen aufgebaut. Auch in der Ausbildung des für die langfristige gesellschaftliche Aufgabe benötigten Nachwuchses hat sich das Projekt verdient gemacht. Diesen Weg gilt es weiter zu gehen und damit die niedersächsische Forschung in diesem gesellschaftlich relevanten Feld weiter zu stärken und zu profilieren. Das Land Niedersachsen ist dazu bereit. Es erwartet aber auch vom Bund, dass er hierfür finanzielle Verpflichtungen eingeht. Schließlich ist die Endlagerforschung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Die Endlagersuche muss wissensbasiert und ergebnisoffen sein. Eine Voraussetzung hierfür ist transparente, kritische und unabhängige Forschung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die die von politischen Weisungen flankierte Ressortforschung des Bundes ergänzt. Diese können wir in Niedersachsen mit den Hochschulstandorten z.B. in Clausthal, Braunschweig, Göttingen und Hannover bieten. Wie wichtig qualitativ hochstehende Forschung mit Transparenz ist, haben wir anhand des Debakels rund um das Atommülllager Asse gelernt. Diese Lernerfahrung ist heute ein Garant für die Transparenz von Endlagerforschung aus Niedersachsen. Wir erwarten aber auch, dass der Bund seine Strukturen neu aufstellt und aus alten Fehlern lernt.
Ausblick
In der öffentlichen Debatte wird immer wieder der wesentlich von der Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Fukushima-Katastrophe angestoßene und in großem Konsens von Bund und Ländern abgestimmte Beschluss zum Ausstieg als das Ende der Atomkraft in Deutschland bezeichnet.
Anrede,
bei aller Anerkennung für den schnellen und konsequenten Auftritt der Bundeskanzlerin im Jahr 2011:
Diese Interpretation enthält zwei grobe Fehler.
1. Vom Ende kann nicht die Rede sein. Was heute auch von früheren Wegbereitern der Atomkraft als Ausstieg und Ende begrüßt wird, ist höchstens ein Anfang. Ein Anfang vom Ende. Noch laufen etliche Atomkraftwerke, noch immer wird weiterer Atommüll produziert, noch wissen wir nicht ob, wann und wo dieser Strahlenmüll eines Tages unter langzeitig sicheren Bedingungen gelagert werden kann.
Und 2.: Zu diesem Anfang vom Ende wäre es nie gekommen, wenn es nicht schon seit über 40 Jahren die Forderung „Atomkraft – Nein danke“ gegeben hätte. Angefangen von kritischen Wissenschaftlern wie Klaus Traube und Robert Jungk, erkämpft von Aktiven in Initiativen, Umweltverbänden, Kirchen und letztlich zur vollen Wirkung gekommen im erbitterten Widerstand der Bevölkerung in Wyhl, Kalkar, Brokdorf, Gorleben und anderswo.
Die Geschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung gehört mit zu den besten Kapiteln der Demokratie im Nachkriegsdeutschland. Sie hat nicht nur dazu beigetragen, dass alternative Technologien zur nachhaltigen Bereitstellung von Strom und Wärme entwickelt wurden. Sie hat die Zivilgesellschaft zu einem sehr lebendigen und unverzichtbaren Teil unserer Demokratie gemacht.
Der Historiker und Publizist Joachim Radkau beschrieb es so: „Die deutsche Anti-Atomkraftbewegung ist aufgrund ihrer Beharrlichkeit der größte und gedankenreichste öffentliche Diskurs in der Bundesrepublik“.
Die deutsche Anti-Atomkraft-Bewegung gilt deshalb zu Recht auch international als Vorbild. Die darin Aktiven haben in einer beispielhaften Konsequenz und Friedfertigkeit nicht nur protestiert und informiert. Sie waren und sind – zusammen mit den sozialen Bewegungen der achtziger Jahre und der Friedensbewegung – ein konstitutives Element für die Stärkung unseres Rechtsstaates geworden. Neben den drei Gewalten und der freien Presse steht heute als fünfte Säule der Demokratie die Zivilgesellschaft.
Deshalb ist diese Regierungserklärung auch eine gute Gelegenheit, den Aktiven und der Bevölkerung in den Brennpunkt-Regionen Dank zu sagen.
Und danken möchte ich an dieser Stelle auch einem besonderen Teil dieser Bewegung. Wer sich insbesondere mit den niedersächsischen Kapiteln der Geschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung beschäftigt, trifft immer wieder auf die Namen von Frauen. Lilo Wollny, Undine von Blottnitz, Freyja Scholing, Marianne Fritzen – und ich glaube es ist nicht vermessen, im gleichen Atemzug auch meine Parteifreundin aus dem Wendland, Rebecca Harms, zu nennen.
Sie alle stehen stellvertretend für die vielen starken, couragierten Frauen, die sowohl politisch als auch sozial, sowohl energisch als auch in der Aktion stets kreativ, vernunftorientiert und deeskalierend zum Zentrum des Widerstandes geworden sind.
Das Ende der Atomkraft in Deutschland wird zuallererst ein Erfolg des unermüdlichen Wirkens der Zivilgesellschaft sein. Diesen Frauen und Männern gebührt die Ehre, den Durchmarsch des Atomstaates gestoppt zu haben.
Dieser Konflikt hat unser Land viele Jahre tief gespalten. Ich möchte mich heute aber gar nicht mehr mit der Rolle der langjährigen Befürworter der Atomkraft beschäftigen. Jede und jeder möge seine Argumente selbst prüfen und sich fragen, warum die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft und unsere Welt mit dieser Technologie einen Irrweg eingeschlagen hat, erst so spät gereift ist. Aber ich kann es niemandem ersparen, an diejenigen zu erinnern, die die Ursachen des tiefen gesellschaftspolitischen Konflikts beispielhaft symbolisieren.
Mit dem Fingerzeig des damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht auf die Landkarte irgendwo bei Gorleben wurde das so genannte KEWA Suchverfahren einfach abgebrochen. 254 Standorte waren auf Eignung für eine Wiederaufarbeitungsanlage mit Endlageroption geprüft worden. Gorleben war ausgeschieden wegen Carnallit-Vorkommen im östlichen Teil des Salzstocks. Gorleben war auch nicht unter den letzten 26 Standorten. Auch nicht unter den letzten drei Standorten.
Ein großer Teil der Wut und Verzweiflung in der Bevölkerung ist auf diese und ähnliche Entscheidungen, Signale und Symbole von damals zurückzuführen. Das zeigt auch die Herausforderung, vor der wir heute stehen.
Gorleben ist nach wie vor Teil des Verfahrens – zusammen mit allen anderen Orten der Republik. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Standort ausscheidet, wenn es tatsächlich ein ergebnisoffenes, transparentes und wissenschaftsbasiertes Verfahren gibt. Mir ist aber sehr bewusst, wie groß im Wendland die Sorgen nach den Erfahrungen der letzten 40 Jahre noch sind.
Zum Irrglauben an die Technologie kam der Irrglaube, dass die Frage der Durchsetzung von Castortransporten und Endlagern schlicht und ergreifend durch die Größe der Polizeieinsätze beantwortet werden könne. Beides war falsch. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt einen neuen Weg einschlagen.
Vertrauen und Verlässlichkeit
Dieser Prozess wird aber nur gelingen, wenn wir Vertrauen aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Das betrifft die Gegner und Befürworter des alten Weges. Das betrifft aber auch das Vertrauen zwischen den Generationen. Nur wenn unsere nachfolgenden Generationen in Gesellschaft und Politik darauf vertrauen können, dass der eingeschlagene Weg richtig ist, wenn die Institutionen vertrauenswürdig sind, wenn kritische Fragen nicht unter den Tisch gekehrt werden, wenn Fehlerkorrektur möglich ist, wird es eine Lösung geben.
Niedersachsen wird genau darauf achten, dass die Vorgaben des Gesetzes im Standortauswahlverfahren umgesetzt werden. Dazu ist eine Mitarbeit, zumindest aber eine Begleitung der Arbeit der Gremien, zwingend nötig. Dazu braucht es weiterhin eine wache Zivilgesellschaft. Das Gesetz setzt schon rein optisch nur die Essenz des 600 Seiten starken Kommissionsberichts um. In Zweifelsfragen kann der Kommissionsbericht daher auch in Zukunft den gesetzlichen Rahmen interpretieren, um den Geist des Kommissionsberichts lebendig zu halten.
Ich danke allen – auch hier im Haus – quer durch alle Fraktionen, die sich für diesen Neubeginn stark gemacht haben.
Ich danke vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielen Ministerien, Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich vielfach deutlich jenseits des üblichen Rahmens eingesetzt haben.
Ich danke vor allem aber auch der Zivilgesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern, den Mitgliedern der Kommission, den Kritikern, die nicht am Tisch saßen, aber mit ihren Beiträgen schon im Laufe des Prozesses die Stärke eines lernenden Verfahrens gezeigt haben.
Der 40-jährige gesellschaftliche Konflikt um die Nutzung der Atomkraft und die sichere Lagerung des radioaktiven Abfalls hat unsere Demokratie lebendiger, widerstandsfähiger und reifer gemacht.
Niedersachsen hat aus einer Sonderstellung heraus einen Neuanfang durchgesetzt und dabei zur Befriedung eines Jahrzehnte währenden Konflikts beigetragen.
Ich sage deutlich, dass diese Menschheitsfrage, verknüpft auch mit dem ernsten Problem der weiteren Verbreitung von Material für die Herstellung von atomaren Massenvernichtungswaffen, es notwendig macht, immer wieder für breite Mehrheiten in Parlament und Gesellschaft zu werben.
Herzlichen Dank fürs Zuhören!