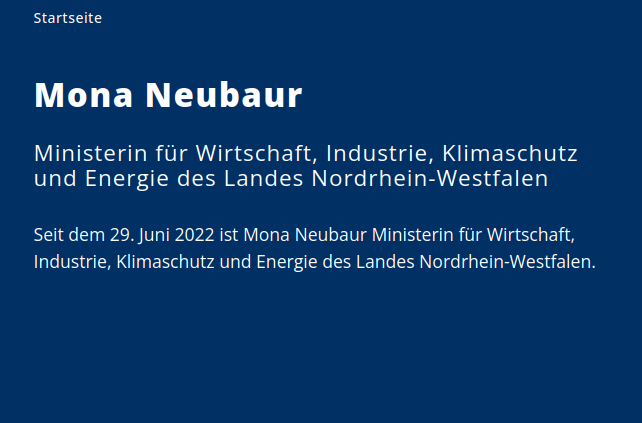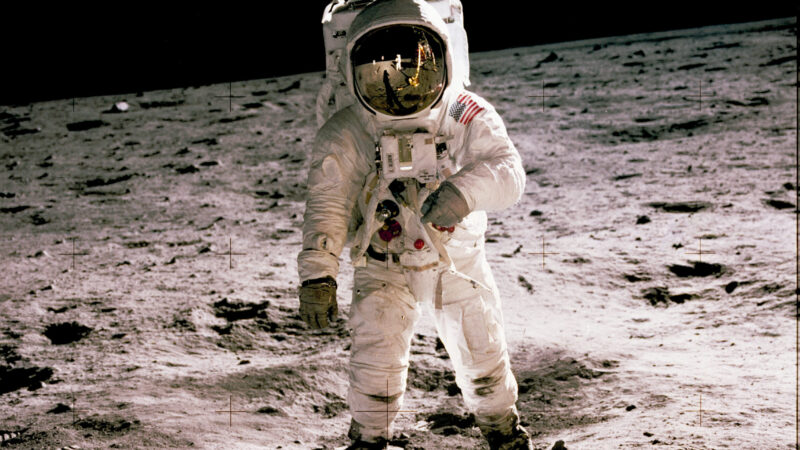Mahnmale oder Denkmale der nuklearen und gesellschaftlichen Kernspaltung

Mit dem Ende der Atomstromerzeugung in Deutschland ist an verschiedenen Orten auch eine Diskussion in Gang gekommen, wie der gesellschaftliche Umgang mit dem nuklearen Erbe aussehen könnte. In Grafenrheinfeld drängelt die Regionalpolitik, nun endlich die weithin sichtbaren Kühltürme am AKW zu sprengen. Im August sollen die Atom-Mahnmale verschwinden. Aus den Augen aus dem Sinn? In Berlin hatten deutsche Wissenschaftler die Kernspaltung mitten im Faschismus entdeckt. Die Geschichte der Atomenergie beginnt im Krieg, mit Atombomben. Erst später werden „Atoms for Peace“ erfunden. „Erinnerungsorte und Wissensspeicher“ heißt eine Veranstaltung des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BaSE) am 1. Juli in Berlin, die darüber nachdenkt, stillgelegte „Atomkraftwerke als Denkmäler“ zu nutzen.
- Siehe unten im Text: Die Einladung und das Programm von BaSE zu der Tagung sowie weitere Beiträge, in denen sich das Bundesamt mit der Frage befasst.
- Bundestag würdigt Anti-Atom-Bewegung für höhere Sicherheit – Verfassungsschutz sieht gewaltbereite Extremisten
- Das Gedächtnis der Anti-AKW-Bewegung – Archiv Deutsches Atomerbe feiert zum 5jährigen Jubiläum Einzug in neue Räume
- “Das Atomzeitalter in Westfalen. Von der Zukunft zur Geschichte” – Eine Wanderausstellung des LWL-Museumsamtes für Westfalen
Auf der Tagung dabei ist der Architekt Philipp Oswalt. In einem Beitrag des NDR vom Februar ist zu lesen, dass er „fordert, dass Kernkraftwerke für die Nachwelt als Kulturgüter bewahrt werden müssen: „Das ist eigentlich selbstverständlich, dass so etwas unter Denkmalschutz kommt.““ (NDR, 20.2.2024) Auch Karsten Hinrichsen aus Brokdorf findet das Thema wichtig, wie er dem NDR mitteilte. Mit Stefan Rettich von der Uni Kassel sprach der DLF zum Thema „Atommeiler als Architekturdenkmäler? Der Stadtplaner Stefan Rettich im Gespräch„. Die Süddeutsche hatte zum Thema im Januar 2023 Überlegungen angestellt. Im Wendland steht das Gorleben-Archiv als Erinnerungs-Wächter und in Braunschweig das Archiv Deutsches Atomerbe.
- Auf etwas über 200 Seiten haben sich Stefan Rettich und Janke Rentrop als Herausgeber mit dem Thema unter dem Titel: Nach der Kernkraft – Konversionen des Atomzeitalters (De Gruyter) befasst. In dem Buch werden zahlreiche Aspekte in einzelnen Beiträgen diskutiert bzw. vorgestellt. Das Inhaltsverzeichnis ist direkt auch hier als PDF einsehbar. (Leider ist das Buch mit 32 Euro nicht eben preiswert). Sophie Jung hat sich mit dem Buch und dem Thema in der Taz zur Jahreswende nach 2023 auseinandergesetzt und getitelt: „Atomkraftwerke als Denkmäler: Nicht geliebte Objekte – Manche wurden von berühmten Architekten gebaut, andere sind Denkmäler der sozialen Bewegungen. Was tun mit den Atomkraftwerken?“ Der Hinweis auf diese Quelle erfolgte über die Perlentaucher.
- Eine umfangreichere PDF mit dem Inhalt und dem ersten Kapitel ist im Internet auf dieser Seite zu finden.
- TÜV-Süd und die bayerische Staatsregierung: Statt Unabhängigkeit und Sicherheit – “Nicht der Genehmigungsbehörde widersprechen”
- Dokumentation: Verfälscht, versäumt, verladen – Untersuchungsausschuss Gorleben – Bilanz politischer Fehlentscheidungen
Dokumentation 1 von BaSE: Atomkraftwerke als Denkmäler: Erinnerungsort und Wissensspeicher
- Der Programmflyer für die Veranstaltung ist direkt auch hier als PDF online.
Vor gut einem Jahr sind die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden. Damit wurde die Stromerzeugung aus dieser Hochrisikotechnologie endgültig beendet. Vorausgegangen war ein jahrzehntelanger gesellschaftlicher Konflikt um die Atomenergie und die Entsorgung ihrer radioaktiven Hinterlassenschaften.
Was wird nun aus den Standorten der Atomkraftwerke? Sollen diese Orte von historischer Bedeutung komplett verschwinden oder können sie als Ort der Erinnerung erhalten bleiben?
Am 01. Juli 2024 lädt das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in Kooperation mit der Universität Kassel und dem Deutschen Technikmuseum Berlin zu einer öffentlichen Fachtagung mit anschließender Podiumsdiskussion nach Berlin ein. Thematisch wird es an diesem Tag um einen umfassenden Blick auf den Denkmalwert von ehemaligen Atomkraftwerken und Möglichkeiten ihrer alternativen Nachnutzungen gehen.
Die Veranstaltung wird um 12:30 Uhr mit Beiträgen von Expert:innen verschiedener Fachrichtungen beginnen. Ab 18:20 Uhr schließt sich eine moderierte Podiumsdiskussion an, die bis etwa 19:50 Uhr dauern wird. Anschließend wird es ein Get-Together geben.
Hier können Sie sich das Programm der Veranstaltung herunterladen.
Montag, 01.07.2024 Von 12:30 Uhr bis 19:50 Uhr mit anschließendem Get-Together Anmeldung für die Veranstaltung
Adresse: Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
Dokumentation 2 – Ausstellung „Nach der Kernkraft – Konversionen des Atomzeitalters“
Schau in Berlin-Tiergarten präsentiert Ideen für AKW-Nachnutzung
- Einige Fotos von der Ausstellung sind hier beim BASE online: Ausstellung „Nach der Kernkraft“ zu Gast im BASE
Deutschland steigt aus der Nutzung der Atomenergie aus. Was bleibt? Rund 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfall muss sicher in einem Endlager untergebracht werden. Und was geschieht mit den Atomkraftwerken? Sie sind Teil der Landschaft geworden. Gibt es neue Verwendungen? Was wäre denkbar?
Studierende der Universität Kassel haben sich Gedanken gemacht, wie eine Nachnutzung aussehen könnte und die Ausstellung „Nach der Kernkraft – Konversionen des Atomzeitalters“ gestaltet. Ihre Ideen sind phantasievoll, visionär, mutig. Es braucht Vorstellungskraft für diese „unbequemen Denkmäler“.
Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat diese Ausstellung in seine Räume nach Berlin-Tiergarten geholt. Denn: Denkanstöße geben, Debatten und Austausch fördern – für ein Bundesamt, das die Öffentlichkeit in seine Arbeit einbindet, ist dies von essenzieller Bedeutung.
Zu sehen ist die Ausstellung vom 15. Dezember bis 15. April täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr im Foyer des
Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
Wegelystraße 8 – 10623 Berlin-Tiergarten.
##
Dokumentation 3 von der BASE Seite – Atomkraftwerke als Denkmäler erhalten? Ein kurzes Interview
Welche Perspektiven bietet die Ausstellung „Nach der Kernkraft – Konversionen des Atomzeitalters“? Darüber sprachen BASE-Präsident Wolfram König und zwei ehemalige Studierende des Fachbereichs Städtebau der Universität Kassel: Rina Gashi, heute Städtebaureferendarin beim Land Niedersachsen, und Marius Freund, heute Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dipl.-Ing. Stefan Rettich.
Was verbindet das BASE mit einer Ausstellung aus dem Fachgebiet Städtebau?
Wolfram König: Mit der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland wird deutlicher wie schwer es ist, die Aufmerksamkeit für die Lösung der sicheren Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig haben wir nicht nur den Auftrag als Gesellschaft, den Ausstieg aus dieser Form der Energieerzeugung einschließlich ihrer Abfälle zu vollziehen, sondern es stellt sich ebenfalls die Frage: Wie können wir mit dem Wissen und den Hinterlassenschaften dieser Technologie so umgehen, dass daraus die richtigen Rückschlüsse für eine zukunftsfähige Lebensweise ermöglicht wird. Die Ausstellung leistet genau hierbei Hervorragendes, denn sie fordert zum Hinterfragen des bisher Selbstverständlichen auf: Statt Abriss der strahlungsfreien Gebäude sollten diese als Lernorte für eine nachhaltige Zukunft genutzt werden.
Welche Motivation hatten Sie als Student:innen, sich diesem Thema zu widmen?
Rina Gashi: Es gab natürlich eine intrinsische Motivation und die Leidenschaft zum städtebaulichen Entwerfen, denn ein AKW ist ebenfalls eine bauliche Anlage, zu der man sich Gedanken machen kann: Wie sieht es eigentlich mit der Nachnutzung dieses Gebäudes aus?
Marius Freund: Wir kennen natürlich die Diskussion in der Familie oder mit Freunden über die Atomkraft. Aber den Ort, den kennt man eigentlich nicht. So ein AKW ist ja auch irgendwie ein mystischer Ort. Zudem haben wir schnell gemerkt: So ein AKW ist echt groß! Und es stecken gigantische Mengen Material darin, wirklich hochwertige Baustoffe – die dann einfach auf Deponien verschwinden. Doch hochverstrahlt ist davon nur ein kleiner Teil. Und da kam dann die Motivation dazu: Das Material kann man noch anders nutzen.
Aus dem stillgelegten AKW Biblis soll ein „Lebenskraftwerk“ entstehen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Rina Gashi: Die Idee ist aus dem Standort des Kraftwerks entstanden: Biblis hat einen speziellen Naturraum. Das AKW selbst liegt eingebettet in Landwirtschaft, Natur- und Vogelschutzgebieten und gehört überdies zum UNESCO-Geopark Bergstraße Odenwald. Somit wirkte das AKW-Gelände wie ein fehlendes Puzzleteil in der Landschaft. Der Titel „Lebenskraftwerk“ kommt daher, weil ein neues Leben für Flora und Fauna, insbesondere für bedrohte Tier- und Pflanzenarten generiert werden soll. Der Gedanke war: Was wäre, wenn das AKW Habitat für bedrohte Tier- und Pflanzenarten werden würde. Es soll aber auch ein Ort für die Bevölkerung geschaffen werden, was natürlich paradox ist, da ein AKW ein sehr verschlossener, für die Öffentlichkeit nicht zugänglicher Ort ist. Es geht also um eine natürliche Rückeroberung dieses Raums.
Und der Plan für das AKW Brokdorf ist in der Ausstellung die Umwandlung in ein „Kernkraftmuseum“. Wie könnte ein solches aussehen?
Marius Freund: Bei der Ankunft im neuen, gläsernen Museumsfoyer starten die großen Betonröhren, die man auch von außen sehen kann. Diese führen über drei Routen durch das Gebäude. Die erste ist die Produktionsroute. Man läuft den Kreislauf ab, der auch zur Stromproduktion genutzt wurde. Die zweite Route ist der Sicherheit gewidmet, denn ich würde schätzen, dass ca. die Hälfte eines AKW-Gebäudes dafür da ist, die Sicherheit zu gewährleisten. Und die letzte Route zeigt dann im Außenraum die Protestgeschichte von Brokdorf, denn das AKW hat ja wegen der Protestkultur eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Wie sehen Sie diese Projekt-Ideen, Herr König?
Wolfram König: Der Wert aller Vorschläge zur Um- und Weiternutzung liegt meines Erachtens insbesondere in der Aufforderung, unseren Blick auf die Anlagen aus einer anderen Perspektive zu richten. Das bisher verfolgte Ziel, die Kraftwerksstandorte wieder zu einer sogenannten grünen Wiese zu machen, muss insbesondere mit den Menschen vor Ort zur Diskussion gestellt werden. Wir dürfen dabei jedoch nicht ausblenden, dass an allen Kernkraftwerksstandorten noch über Jahrzehnte Zwischenlager mit hochradioaktiven Abfällen existieren werden. Eine Hypothek aus dem Kernkraftwerksbetrieb, die die Nutzungsmöglichkeiten einschränken und uns gleichzeitig mahnen, konsequent die Standortfrage für ein Endlager in Deutschland einer Beantwortung zuzuführen.