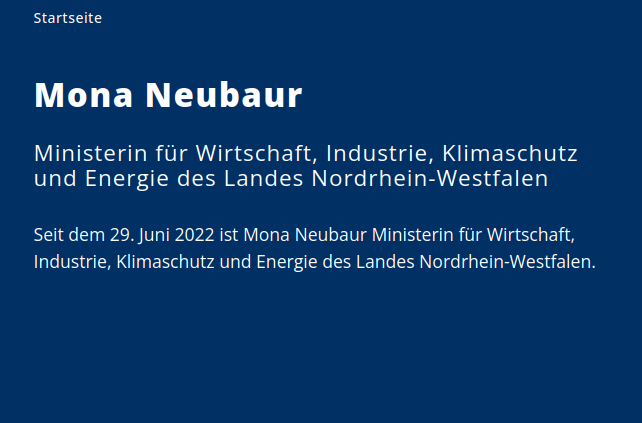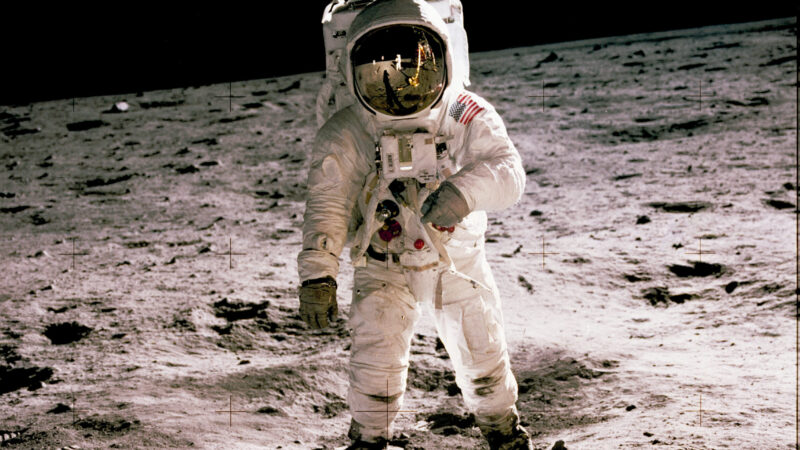Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan: Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energienetze als großer Erfolg – der in der Umsetzung beinahe noch gescheitert wäre

umweltFAIRaendern dokumentiert. Rede Grüner Umweltminister, Hamburg.Rekommunal-Gemeinwohl! In voller Länge, im Original. Mit nur wenig Kommentar. Bitte was? Im September hat Hamburg den zehnten Jahrestag des erfolgreichen Volksentscheids zur Rekommunalisierung der Energienetze für Strom, Gas und Wärme gefeiert. Ein wegweisender Impuls für Demokratie, für Klimaschutz, für soziale Gerechtigung und Gemeinwohl. Initiatoren und Verbände, die den Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ auf den Weg gebracht hatten verananstalteten Ausblick und feierten Erfolg. Die Akademie der Wissenschaften diskutierte Gemeinwohl und Daseinsvorsorge für den Klimaschutz in einer Veranstaltung samt Grußwort vom Akademiepräsidenten und Klimaexperten Prof. Dr. Mojib Latif. Die Linksfraktion mit dem für öffentliche Unternehmen zuständigen Abgeordneten Norbert Hackbusch sorgte mit einer Großen Anfrage in der Bürgerschaft dafür, dass Rekommunalisierung und der Gewinn für Hamburg und Klimapolitik auch im Landesparlament Thema wurde. Und der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan machte den Erfolg nicht nur mit einer Pressemitteilung deutlich, sondern lud außerdem zum Senatsempfang für die Initiator:innen des Volksentscheids. Ein SPD-Senator fehlte, – ebenso wie ein ernsthafter sonstiger Beitrag aus den Reihen der SPD-Führung, die damals „volle Kanne“ gegen die Rekommunalisierung unterwegs war und heute (kleinlaut) einräumt, wie wichtig ist es, die Instrumente für Energie- und Klimapolitik in den eigenen Händen zu haben. UmweltFAIRaendern dokumentiert (exklusiv?) die Rede von Senator Jens Kerstan auf dem Senatsempfang am 23. September 2023. Die ist nicht nur wichtig, weil Kerstan die Erfolge der Rekommunalisierung betont. Er erzählt auch noch mal, wie knapp es war, dass die von der SPD verschuldete verspätete Übernahme ausgerechnet der besonders wichtigen Fernwärme von Vattenfall in die Hände der Stadt beinahe doch noch an den Deals der SPD-Spitze gescheitert wäre.
Einiges ist sehr grün gefärbt, einiges vom Dauer-Pressing der Volksentscheids-Akteure fehlt. Aber Kerstan spricht von Ecken, Kanten und Kontroversen, die am Ende einen wichtigen Akt von demokratischen Engagment der Bürger:innen gegen die scheinbar Übermächtigen zur Folge hatte. Erinnern ist für die Zukunt wichtig! Tell me about Ben Schlemmermeier!
umweltFAIRaendern hat über das Jubiläum des Volksentscheids zuletzt berichtet:
- Zehn Jahre Volksentscheid “Unser Hamburg Unser Netz” – damals gegen Scholz und Vattenfall – heute: Bürgerschaft, Senat, NGOs und Wissenschaft bilanzieren rekommunalisierte Energienetze
- In einer umfassenden Reihe hat umweltFAIRaendern mit Untertüzung der Hamburger Linksfraktion über die Vorgeschichte und den Verlauf der Volksinitiative bis zum Volksentscheid in analytischen Hintergrundtexten berichtet. Außerdem präsentierte umweltFAIRaendern drei Statements zur Bilanz des Volksentscheids „Unser Hamburg – Unser Netz“ von den Vertrauenleuten der Initiative Manfred Braasch (Umwelt), Theo Christiansen (Kirche) und Günter Hörmann (Verbraucherschutz). Siehe hier: 10 Jahre Volksentscheid “Unser Hamburg Unser Netz” – Ein Zwischenstand über Daseinsvorsorge, Klima und Demokratie zur Rekommunalisierung der Energienetze
- Die Debatte der Großen Anfrage von Hackbusch und der Linksfraktion in der Bürgerschaft ist hier online: Bilanz des Senats zu „Unser Hamburg – Unser Netz“- Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE – (30:18) (Mediathek der Bürgerschaft, Videolink). Die Große Anfrage samt Antworten ist hier als PDF online (Drucksache 22/12714).
- Die Homepage der Volksentscheids-Initiative Unser Hamburg Unser Netz ist online weiterhin verfügbar, weil umweltFAIRaendern.de die Seite (re)hostet. Wer unterstützen möchte, dass diese Seite auch in Zukunft online ist, kann per Mail Kontakt aufnehmen. Die Seite war wenige Monate nach dem Ende der Volksinitiave „sich selbst“ überlassen. Virenangriffe und fehlende Updates hatten dafür gesorgt, dass die Domain schließlich abgeschaltet wurde und aus dem Internet nicht mehr zu finden bzw. zu öffnen war. umweltFAIRaendern hat eine letzte Sicherung der Netze-Homepage genutzt und mit solidarischer Unterstützung von politischern IT-Creativ-Menschen dafür gesorgt, dass ein gesichertes Update wieder weltweit online verfügbar ist. Weil es sich lohnt, wie wir damals gesagt haben. Und damit ein historisches Kapitel von regionaler, sozial-ökologischer Politik für Demokratie und von Unten recherchierbar und erinnerbar bleibt.
- Ben Schlemmermeiner, die LBD und ein Gutachten: Rekommunalisierung der Hamburger Fernwärmeversorgung. Ökonomischer und ökologischer Nutzen für Hamburg, durch die LBD-Beratungsgesellschaft. Stand 05. September 2013. Lange Fassung. Siehe das Gutachten auch hier direkt als PDFauch hier direkt als PDF. Siehe auch hier: SPD und Energienetze Hamburg – Machtpolitik statt gute Geschäfte für die Stadt Hamburg und die BürgerInnen!
- Die LBD hatte zuerst die Hamburger Umweltbehörde unter Umweltsenator Alexander Porschke in energiepolitischen Fragen beraten. Im Rahmen der ersten rot-grünen Koalition ging es in Sachen Atomausstieg der damals in städtischem Besitz befindlichen Aktiengesellschaft HEW darum, die Reaktoren zumindest Schritt für Schritt aus ! wirtschatlichen! Gründen abzuschalten. Die Alternative zu Atommüll und Super-Gau/Tschernobyl waren Gaskraftwerke. Die LBD hatte sollte damals bewerten, unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen die Abschaltung des AKW Brunsbüttel für eine Aktiengesellschaft ermöglicht würde.
umweltFAIRaendern.de dokumentiert exklusiv:
Die Rede von Hamburg Umwelt- Senator Jens Kerstan beim Senatsempfang aus Anlass des zehnten Jahrestags des Volksentscheids über den Rückkauf der Hamburger Energienetze am 23. September 2023
Sehr geehrter Herr Vizepräsident der Bürgerschaft Herr Schmitt,
Meine Damen und Herren Abgeordnete,
Und, stellvertretend für die Volksinitiative:
Sehr geehrte Herren Christiansen, Braasch, Dr. Hörmann, sehr geehrte Frau Hansen,
Lieber Theo, lieber Manfred, lieber Günter, liebe Wiebke,
Meine Damen, meine Herren, liebe Gäste!
Im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg begrüße ich Sie zum Senatsempfang anlässlich des Jubiläums zehn Jahre „Unser Hamburg – Unser Netz“.
Auch wenn ich hier den ganzen Senat vertrete, erlauben Sie mir, mit einer persönlichen Anmerkung zu beginnen. Allen, die am 22. September 2013 dabei waren, war klar, dass der gewonnene Volksentscheid für Hamburg ein historisches Datum sein würde, und so ging es auch mir, als Fraktionsvorsitzendem einer Oppositionspartei, der sich persönlich sehr für den Volksentscheid eingesetzt hatte.
Ich kann sogar sagen, mir war damals klar: Für mich wird das immer einer der wichtigsten Tage und einer der größten Erfolge in meiner gesamten politischen Laufbahn sein.
Aber: dass ich zehn Jahre später die Gelegenheit haben würde, Sie zu einem Senatsempfang einzuladen, um als zuständiger Fachsenator im Senat auf dieses Datum und seine großen, weitreichenden Wirkungen zurückzuschauen, wer hätte das damals ahnen können – ich mit Sicherheit nicht, selbst in meinen wildesten Träumen.
Deshalb darf ich Ihnen und euch sagen: Es ist mir nicht nur ein Privileg und eine besondere Ehre – sondern auch ein ganz besonderes Vergnügen.
Deshalb noch einmal: Ich freue mich sehr, Sie alle im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg zu diesem Senatsempfang aus Anlass des zehnten Jahrestags des Volksentscheids über die Energienetze begrüßen zu dürfen.
Die Mehrheit für die Vorlage von „Unser Hamburg – Unser Netz“ am 22. September 2013 war ein Wendepunkt für die Energiepolitik in unserer Stadt, aber nicht nur für die Energiepolitik, sondern weit darüber hinaus.
Mit diesem Senatsempfang wollen wir das Engagement der Bürgerinnen und Bürger würdigen, durch die dieser entscheidende Schritt damals möglich wurde. Mit der Mehrheit im Volksentscheid haben die Hamburgerinnen und Hamburger ihrer Bürgerschaft und ihrem Senat einen sehr klaren und gleichzeitig sehr umfassenden Auftrag erteilt, der, wie es sich später zeigte, gar nicht so einfach umzusetzen war.
Darum lassen Sie uns auch einen Blick darauf werfen, was die Entscheidung bis heute bewegt hat, und vielleicht auch darauf, was uns die Erfahrungen von damals in der heutigen Lage, angesichts heutiger Herausforderungen und Konflikte, noch zu sagen haben.
Dem soll insbesondere das Podium dienen; wir haben versucht, es so zu besetzen, dass verschiedene Perspektiven auf den Volksentscheid zur Geltung kommen. Denn auch die Volksinitiative war einebunte und heterogene Truppe, und vermutlich hat nicht zuletzt das ihre Stärke ausgemacht.
Der Erfolg der Volksinitiative war umso bemerkenswerter, weil ihm ein sehr ungleicher Kampf vorausgegangen war. Die Volksinitiative sah sich einer großen Koalition gegenüber aus Senat und Regierungsfraktion mit absoluter Mehrheit, zwei der vier Oppositionsfraktionen, allen maßgeblichen Wirtschaftsverbänden, und mit sehr viel Rückenwind der veröffentlichten Meinung, und, nicht zu vergessen, einer etwas bizarren Gegen-Volksinitiative, die sich für ein „gutes“, aber auf keinen Fall für ein eigenes Netz einsetzte.
Sie alle hatten sich an die Seite des Großkonzerns Vattenfall gestellt, der gerade dabei war, ein gigantisches Kohlekraftwerk mitten in Hamburg zu errichten, um die Hamburger Fernwärme mindestens bis zur Mitte des Jahrhunderts an fossile Energien zu binden, was alle Klimaziele der Stadt ad absurdum geführt hätte.
Dieses Bündnis verfügte nicht nur über schier unbegrenzte Mittel für ganzseitige Zeitungsanzeigen und ganze Hefte als Wochenendbeilagen großer Zeitungen, und das nicht nur einmal, sondern regelhaft – das war schon derStandard. Sondern es konnte über viele Kanäle versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. So endeten alle E-Mails der Handwerkskammer an Handwerksbetriebe, Kund:innen, Interessenten oder Mitarbeitende der Verwaltung mit dem knackigen,unmissverständlichen Satz: „Gegen den Volksentscheid.“ Dieses mächtige Bündnis schreckte auch nicht davor zurück, gelegentlich die Grenzen des Zulässigen zu überschreiten. Etwa als die zu Neutralität verpflichtete Stromnetzgesellschaft eine eigene Kampagne gegen ihren eigenen Rückkauf startete.
Und auch die Handelskammer musste für ihreeinseitige Parteinahme nachträglich einen harschen Rüffel vom Verwaltungsgericht einstecken. Ihr Verhalten war schlicht rechtswidrig!
Für den Volksentscheid hatte das zwar keine Folgen mehr, wohl aber für die Kammer selbst. Ohne Frage war dies der entscheidende Impuls dafür, dass die Handelskammer-Rebellen breite Unterstützung bekamen. Hatte die Kammer doch mit ihrer einseitigen Stellungnahme für den Atom- und Kohlekonzern Vattenfall gleichzeitig gegen die Interessen vieler Start-ups, kleiner und mittlerer Unternehmen und Dienstleister, die sich gerade auch im Bereich Erneuerbare Energien tummelten,verstoßen, die „not amused“ über das waren, was mit ihren Zwangsmitgliedsbeiträgen angestellt wurde.
Und auch die Minderheitsbeteiligung der Stadt an den Netzgesellschaften im November 2011 konnte man als fragwürdig ansehen. Wurde sie doch sehenden Auges eingegangen, um einen möglicherweise kommenden Volksentscheid auszubremsen. Sie hat jedenfalls für den Rückkauf der Fernwärme sehr schwierig zu überwindende Voraussetzungen geschaffen.
Die damals vorgetragenen inhaltlichen Thesen: dass der Rückkauf ein Zwei-Milliarden-Loch in den Haushalt reißen würde, dass man mit Kabeln und Rohren keine Energiepolitik machen könne, und dass mit Fernwärme sowieso kein Geld zu verdienen sei – sie erscheinen aus heutiger Sicht absurd und aus der Zeit gefallen.
Diese Thesen werden inzwischen von unseren rekommunalisierten Energieunternehmen durch ihre tägliche Arbeit abschließend und praktisch wiederlegt.
Diesem kompakten und mächtigem Block der Gegner stand „Unser Hamburg – Unser Netz“ gegenüber, als Volksinitiative getragen von einem sehr breiten und bunten Bündnis von attac bis Zukunftsrat, und repräsentiert von drei Vertrauensleuten, die man als Vertreter respektabler Organisationen nur schwer in die gewünschte extremistisch-staatsfeindliche Ecke stellen konnte.
Diese Vielfalt, von bürgerlicher Gediegenheit bis weit in alternative, politisierte, aber parteienferne Milieus hinein, die ich als Vertreter einer Partei im Bündnis vielleicht sogar als sehr parteienkritisch wahrgenommen habe, hat der Initiative in der Auseinandersetzung einen klaren Glaubwürdigkeitsvorsprung gegeben.
Was ihr an finanziellen Mitteln gefehlt hat, hat sie durch Einsatz und Fantasie und nicht zuletzt durch die besseren Argumente wett gemacht.
Und schließlich fand die Initiative auch nicht im luftleeren Raum statt.
Die These, dass Eigennutz stets zum Allgemeinwohl führt und dass privat immer besser ist als staatlich, hatte während Finanzkrise und Bankenrettungerheblich an Strahlkraft und an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Konzessionsverträge liefen überall in Deutschland Mitte der Zehner-Jahre aus und es gab einen allgemeinen Trend zur Rekommunalisierung.
Und schließlich hatte in Hamburg auch die institutionalisierte Politik vorgearbeitet: Christian Maaß, ein junger grüner Bürgerschaftsabgeordneter und späterer Umweltstaatsrat, hatte das Thema 2007 auf die politische Agenda gesetzt und 2008 dazu immerhin einen Prüfauftrag in den schwarz-grünen Koalitionsvertrag hineinbekommen.
Aus der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt heraus haben Anja Hajduk und er als Staatsrat dem damaligen Mitarbeiter der Verwaltung Matthias Sandrock den Auftrag gegeben, diesen Punkt des Koalitionsvertrages zu bearbeiten. Dazu musste er aus allen Strukturen herausgelöst werden, da Referats- und Abteilungs- bis hin zu Amtsleitungen in der Umweltbehörde eine grundsätzliche und heftige Abneigung gegen die Idee einer Rekommunalisierung hatten. Letztlich gelang es zunächst nur, das VersorgungsunternehmenHamburg Energie neu zu gründen, als Wiedereinstieg in eine kommunale Energiewirtschaft.
Nach dem Ende von Schwarz-Grün war deshalb die Volksinitiative die einzige Chance, eine Wende in dieser entscheidenden Frage der Rekommunalisierung hinzubekommen.
Die Bürgerschaft blieb dabei aber ein entscheidendes Forum, um dem Anliegen Öffentlichkeit zu verschaffen und die Debatte voranzutreiben.
Dafür habe ich damals als Fraktionsvorsitzender die Funktion des energiepolitischen Sprechers übernommen und wir haben das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht, durch Anfragen, Anträge und Pressetermine – bis zum letzten großen Schlagabtausch in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft vier Tage vor der Abstimmung.
Das Ergebnis war knapp, aber eindeutig, und darauf kommt es an. 50,9 Prozent sind jedenfalls nicht schlechter als die 48 Prozent, der die SPD zu der Zeit ihre absolute Mehrheit verdankte.
Ein Selbstläufer war die Umsetzung trotzdem nicht.
Zwar hatte der Senat den Rückkauf des Stromnetzes zunächst sehr schnell und geschmeidig umgesetzt, gefolgt vom Gasnetz.
Aber das Herzstück des Volksentscheids, der Rückkauf der Fernwärme mit all den Kraftwerken und auch den Kunden – ein großer Hebel für Klimaschutz – stand lange auf der Kippe
Als ich 2015 das Amt des Energiesenators angetreten habe, wurde ich mit der Situation konfrontiert, die die Minderheitsbeteiligung des Vorgänger Senates geschaffen hatte.
Denn wohl wissend, dass ein Volksentscheid erfolgreich sein könnte, kaufte der damalige, mit absoluter Mehrheit regierende Senat unter Bürgermeister Olaf Scholz eine Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent. Zwar wurde mit der städtischen Beteiligung 2011 eine Rückkaufoption für den Fall eines erfolgreichenVolksentscheids vereinbart – so weit, so gut – aber gleichzeitig wurde auch ein extrem hoher garantierter Mindestpreis vereinbart. Als wir uns den genauer anschauten, entpuppte sich das nicht als ein kleines,mit Haushaltstechnik zu lösendes Problem, sondern dieser Mindestkaufpreis lag so weit über dem aktuellen Unternehmenswert, dass das Haushaltsrechtden Rückkauf zuverlässig auszuschließen schien.
Auf dieser Lage hatten wir lange herumzukauen.Gleichzeitig musste meine Behörde mit Vattenfall weiter die Fernwärmeplanung für den Ersatz des Kraftwerks Wedel verhandeln. Dort gab sich der Atom- und Kohlekonzern Vattenfall auf einmal sehr geschmeidig, ein klimaschonendes Konzept aus erneuerbaren Energien, vorhandenen Abwärmequellen und einer innovativen großen Wärmepumpe in unserem zentralen Klärwerk umsetzen zu wollen.
Vattenfall schien sich auch letztlich damit abzufinden, dass das Kohlekraftwerk Moorburg nicht an das große Fernwärmenetz nördlich der Elbe angeschlossen würde. Und so war plötzlich bei Vatenfall und auch bei manchen im Senat und der Koalition die Rede davon, dass dies doch ein guterKompromiss sei: Vattenfall akzeptiert einökologisches Erzeugungskonzept, behält aber die Mehrheit an dem Unternehmen.
Unsere Hinweise, wozu ein Kompromiss – derVolksentscheid war doch erfolgreich – wurde milde belächelt und mit einem Schulterzucken abgetan.
Letzten Endes hatten wir in der Umweltbehörde damit ein Unternehmenskonzept entwickelt, mit dem wir zeigen konnten, dass eine Neuausrichtung des Unternehmens auf ökologische Wärmeversorgung auch seine Werthaltigkeit steigern würde, was uns hoffen ließ, damit die Haushaltsschranke zu überwinden. Es zeigte sich aber schnell, dass auch dieses immer noch nicht ausreichte, den enormen Mindestkaufpreis zu rechtfertigen.
Bei uns in der Behördenleitung machten sich erste Anzeichen von Depression bemerkbar, da uns immer klar war, ohne hundertprozentige Umsetzung des Volksentscheides können wir nicht weitermachen.Aber es gibt da diese wunderbare Volksweisheit: „Wenn du denkst es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“
In unserem Fall hatte das Lichtlein einen Namen Ben Schlemmermeier, Partner des Energieberatungsunternehmens LBD. Mit beeindruckender Statur und im Porsche vorfahrend,fügte er den Befürwortern des Volksentscheids eine weitere bunte Farbe zu. Kurz vor Verabschiedung der Drucksache, mit der der Senat der Bürgerschaft zur Umsetzung des Volksentscheids berichtete, und die zwar verklausuliert, aber doch erkennbar die niederschmetternde Botschaft hatte, dass ein Rückkauf trotz aller Mühen und Anstrengungen aufgrund des Haushaltsrechts leider nicht möglich ist, rief der mir bis dahin unbekannte Ben Schlemmermeier mich an und fragte mich nach allen möglichen, mir bis dahin noch nicht unter gekommene Dingen, wie z.B. Ertragswertbewertung. Wir schummelten auf dieser Grundlage in letzter Minute zwei diese Aspekte zu beleuchtende, in Auftrag zu gebende Gutachten in die Drucksache, mit denen es uns dann im weiteren Verfahren gelang,darzustellen, dass bei einer alternativen, ungewöhnlichen, aber zulässigen Bewertung zusammen mit der ökologischen Wertsteigerung ein Rückkauf auch aus Haushaltssicht möglich war.
Es wurde angesichts dieser Erkenntnisse dann eine Zeit lang doch noch ziemlich ruppig und ungemütlich. Die Gesprächsatmosphäre mit Vattenfall verschlechterte sich schlagartig, was überraschenderweise auch auf die Gespräche innerhalb der Koalition zutraf. Vorsichtig formuliert war es kein Nachteil für den Volksentscheid, dass in dieser heiklen Situation eine grüne Umweltbehördenleitung, mit voller Rückendeckung der grünen Partei und der grünenBürgerschaftsfraktion, ohne Wenn und Aber klar machte, dass diese Koalition nur bei vollständiger Umsetzung des Volksentscheids weitermachen könnte. Dem konnten sich letztlich auch Bürgermeister und Finanzbehörde nicht entziehen, so dass der Rückkauf der Fernwärme 2019 haushaltsrechtlich möglich wurde.
Nebenbei haben wir so auch gezeigt, dass Energiewende und Klimaschutz die nachhaltigen Geschäftsmodelle sind, während die fossilen Assets sich immer schneller entwerten.
So auch das Kraftwerk Moorburg. Bei der Inbetriebnahme, wenige Tage vor der Pariser Klimakonferenz 2015, hatte der damalige Erste Bürgermeister noch von 40 bis 50 Jahren Laufzeit gesprochen. Nach dem Fernwärme-Rückkauf hat Vattenfall dann jedoch zu aller Erstaunen, und zumEntsetzen von manchen, die Stillegungsprämie von Herrn Altmaier eingestrichen und dann selbst das Kohlekraftwerk abgeschaltet. Auch diese vielen Millionen Tonnen CO2-Einsparung verdanken wir letztlich dem Erfolg der Volksinitiative.
Heute höre ich auf Energieminister-Konferenzen, dass wir in Hamburg doch eine geradezu idealtypische Situation für die Verwirklichung der Energiewende hätten. Tatsächlich sind unsere rekommunalisierten Unternehmen heute die entscheidenden Akteure und Treiber der Energiewende in Hamburg. Stromnetz Hamburg hat seine Investitionen vervielfacht, um den Anforderungen der Elektrifizierung in allen Sektoren gerecht zu werden. Gasnetz Hamburg kann in der Familie der Unternehmen eine neue Schlüsselrolle für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur spielen. Die rekommunalisierte Wärme Hamburg und die städtische Gründung Hamburg Energie haben inzwischen zu den Hamburger Energiewerken fusioniert. Sie stemmen die gewaltige Aufgabe der Wärmewende und sind die Säulen unserer Wasserstoffprojekte.
Unsere kommunalen Energieunternehmen sind in vielen Bereichen technologisch führend. Das betrifft die Integration von Abwärme aus der Industrie oder von den Schwesterunternehmen Stadtentwässerung und Stadtreinigung genauso wie die Planungen für große Flusswasser-Wärmepumpen. Die Tiefengeothermie Wilhelmsburg ist ein riesiger Schritt für diese Form der Energiegewinnung und ein Meilenstein für die ganze Norddeutsche Region. Niemand anders als unsere städtischen Unternehmen wäre diese Wagnisse eingegangen, erneuerbare Energien zu entwickeln und marktfähig zu machen. Pivate Investoren hätten so geringe Renditen und solche technologischen Risiken nicht akzeptiert.
Risikobereitschaft aus gesellschaftlicher Verantwortung – so lässt sich vielleicht der Geist dieser Unternehmen heute am besten kennzeichnen.
Mit der Rekommunalisierung hat sich die Stadt ein ganz neues Handlungsfeld erschlossen. Energiewende und Klimaschutz sind bei den Unternehmen als Ziel fest verankert. Damit ist ein wichtiger Teil fortschrittlicher Energiepolitik unabhängig von den parteipolitischen Konjunkturen, die die Senatspolitik beeinflussen.
Dabei hat der Netze-Volksentscheid auch bleibende Spuren in der Hamburger Politik hinterlassen. Die rechtswidrige Parteinahme gegen die Volksinitiative hat dazu geführt, dass 2017 das Handelskammer-Establishment von den Kammer-Rebellen weggefegt wurde. Inzwischen sind die Verhältnisse dort schon wieder andere; aber der Alleinvertretungsanspruch der Kammer in allen Feldern der Politik in Hamburg ist damit Geschichte, und das ist aus meiner Sicht auch ganz gesund für die demokratische Verfasstheit unserer Stadtrepublik.
Geändert hat sich mit dem 22. September 2013 auch der Umgang der Politik mit Volksinitiativen. Bürgerschaft und Senat haben nicht noch einmal den harten Konflikt gesucht. „Tschüss Kohle“ und „Hamburgs Grün erhalten“ sind von der Bürgerschaft auf dem Wege von Verhandlungen übernommen worden; beide Male zum Vorteil der Stadt, und beide Male hat übrigens meine Behörde die Verhandlungspartner beraten und die konkrete Umsetzung mit erarbeitet.
Selbstverständlich sind mit dem Volksentscheid die zugrundeliegenden Frontstellungen und ideologischen Gegensätze nicht endgültig überwunden worden. Aber wir können heute festhalten:
„Unser Hamburg – Unser Netz“ hat eines der größten Infrastruktur-Projekte in der Geschichte unserer Stadt auf den Weg gebracht – und gleichzeitig die größte Rekommunalisierung in Deutschland.
Die Initiative hat einen Wandel in Gang gesetzt, ohne den wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen und eine zukunftsfähige Energieversorgung nicht gewährleisten könnten. Sie hat die Politik in unserer Stadt verändert; sie hat viele, sehr unterschiedliche Menschen zusammengebracht, die sich aber einig waren in ihrem Ziel und in ihrem Engagement für ihre Stadt und die erlebt haben, dass ihr Engagement etwas bewirkt hat – zum Guten!
Das scheint mir heute in der aktuellen politischen Lage eine ermutigende Botschaft zu sein. Wo aufeinmal Klimaschutz wieder in einen grundsätzlichenRechtfertigungszwang gerät und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung von immer stärker werdenden politischen Kräften in Frage gestellt wird. Wobei man feststellen muss, dass die vehementesten Gegner einer verantwortlichen Klimapolitik sehr häufig auch die gleichen Kräfte sind, die unser demokratisches parlamentarisches System versuchen zu untergraben und in Frage stellen.
Dem steht, wie ich finde, die positive Botschaft des gewonnenen Volksentscheids „Unser Hamburg – Unser Netz“ entgegen: All die Anstrengungen, die Mühen, die Kämpfe der Bürger:innen, die sich einmischten und engagierten: sie haben sich gelohnt! Sie haben Entscheidendes bewirktund eine grundsätzliche Wende in der Energiepolitik und der politischen Kultur unserer Stadt erreicht.
Ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf und sagen kann – und zwar, wie es meiner Rolle hier entspricht – im Namen des Senats der Freien und Hansestadt: Danke an alle, die an die Sache geglaubt und den Erfolg möglich gemacht haben. Die dafür bei Wind und Wetter auf der Straße waren oder bis tief in die Nacht am Schreibtisch. An die, die sich in der Initiative, in Verbänden, Gremien und Behörden für die Umsetzung eingesetzt haben und weiter einsetzen. Und an die natürlich, die heute in unseren städtischen Energieunternehmen daran arbeiten, das zu verwirklichen, was der Volksentscheid auf den Weg gebracht hat.
Ich freue mich auf die Gespräche, und ich wünsche mir, dass wir aus der Besinnung auf einen großen gemeinsamen Erfolg Kraft ziehen für das, was noch vor uns liegt.
Schön, dass ihr heute gekommen seid!
Vielen Dank.
Jens Kerstan, Umweltsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Rede wurde vom ihm auf dem Senatsempfang aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums des erfolgreichen Volksentscheids „Unser Hamburg – Unser Netz“ gehalten. Es gilt das gesprochene Wort.
Dokumentation 2: PM der Umweltbehörde zum Volksentscheid:
Zehn Jahre Rückkauf der EnergienetzeEin Gewinn für Hamburg und das Klima
18. September 2023
Im September 2013 setzte der Volksentscheid für den Rückkauf der Energienetze in Hamburg einen entscheidenden Meilenstein für die städtische Energiepolitik. Ein Jahrzehnt nach dieser richtungsweisenden Entscheidung ziehen die zuständigen Behörden und Unternehmen – die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA), die Finanzbehörde, die Hamburger Energiewerke, Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg – eine positive Bilanz. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Volksentscheids hat eine solide Grundlage für eine nachhaltige, sozial ausgewogene, klimaverträgliche und demokratisch kontrollierte Energie- und Wärmeversorgung in Hamburg geschaffen.
Der Volksentscheid im Jahr 2013 ermöglichte es den Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs, aktiv über die Zukunft ihrer Energienetze zu entscheiden. Das Ergebnis war eindeutig: Die Energienetze sollten wieder in städtischen Besitz übergehen. Dies betrifft die Netzinfrastrukturen für Strom, Gas und Fernwärme. Der Senat hat diese demokratische Entscheidung konsequent und engagiert in die Tat umgesetzt.
Jens Kerstan, Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: „Mit der Entscheidung zur Rekommunalisierung der Energieunternehmen und der Netze hat Hamburg auf ganzer Linie gewonnen. Wir konnten damit vor zehn Jahren den Grundstein für den zügigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen legen und die Energie- und Klimapolitik wieder aktiv gestalten. Heute sind es die städtischen, kommunalen Akteure, die die Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Hamburger Energiewende spielen. Die städtischen Unternehmen führen unter der Kontrolle des Senats energiepolitische Projekte gemeinwohlorientiert durch und müssen keine hohen Renditen für international operierende Konzerne abführen. Im Gegenteil: Die Gewinne und die Wertschöpfung dieser Gesellschaften kommen ganz Hamburg zugute. Wir arbeiten mit unseren Energieunternehmen an der Wärmewende und sind mit vielen Projekten bundesweit Vorreiter wie bei der Nutzung von industrieller Abwärme, großindustriellen Wärmepumpen, Power-to-Heat-Anlagen oder der Fernwärmeleitung unter der Elbe. Auch der Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft mit dem Green Hydrogen Hub Moorburg und dem Wasserstoffindustrienetz bringen wir mit unseren Unternehmen voran. Die Hamburger:innen haben beim Volksentscheid zur Rekommunalisierung weise und zukunftsorientiert entschieden. Ich bin stolz darauf, was wir mit unseren Energieunternehmen aus dieser bahnbrechenden Entscheidung gemacht haben.“
Finanzsenator Andreas Dressel: „Wir haben den Volksentscheid beherzt umgesetzt und können nun nach zehn Jahren erste positive Ergebnisse sehen, auch wenn es für eine Schlussrechnung sicherlich noch zu früh ist. Natürlich ist es in der Zeit der Energiekrise und Klimawende heute besser, dass die Stadt im Fahrersitz nun die Richtung bestimmen kann. Wir haben jetzt starke städtische Unternehmen, die gut aufgestellt sind – und sind damit auch im bundesweiten Vergleich ganz vorne. Das steht politisch auf der Habenseite. Klar ist natürlich, dass es bei den Unternehmen auch wirtschaftlich langfristig tragfähige Geschäftsmodelle geben muss. Die Stadt hat für den Kauf von Strom-, Gas- und Fernwärmegesellschaften mit allen Anschaffungsnebenkosten bisher 1,93 Milliarden Euro investiert. Von 2012 bis heute haben die Unternehmen rund 647 Millionen Euro an die Stadt abgeführt, es sind also etwa ein Drittel der Einnahmen wieder hereingekommen. Nun gilt es, diese Erfolgsgeschichte in den kommenden Jahren fortzuführen.“
Christian Heine, Sprecher der Geschäftsführung, Hamburger Energiewerke: „Der Rückkauf der Netze hat sich für Hamburg, seine Bürgerinnen und Bürger, und das Klima gelohnt. Allein bei den Hamburger Energiewerken investieren wir bis 2027 1,9 Milliarden in die Energie- und Wärmewende in unserer Stadt. Wir leisten so den größten Einzelbeitrag zu Hamburgs Klimazielen aber auch einen erheblichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Über Investitionen in Hamburgs Zukunft wird wieder vor Ort entschieden! Es ist nicht mehr die höchste internationale Rendite, die den Ausschlag gibt, wo wichtige Infrastrukturprojekte umgesetzt werden.“
Andreas Cerbe, Geschäftsführer Stromnetz Hamburg: „Der Rückkauf der Hamburger Stromnetz war nach dem Volksentscheid ein Meilenstein für die Stromnetz Hamburg und weitsichtig für die absehbaren Herausforderungen im Energiemarkt. Gemeinsam mit unseren Schwesterunternehmen haben wir einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Kurs eingeschlagen; die Energiewende stets fest im Blick. Die umfassende Elektrifizierung aller Sektoren bedeutet einen deutlichen systemischen Wechsel der Energieversorgung in Hamburg, die auch unsere Stromnetze fordert. Eine zukunftsfähige Netzinfrastruktur steht im Zentrum unseres Handelns, damit wir gemeinsam mit den Bürger*innen die nachhaltige Wärme- und Mobilitätswende vorantreiben können.“
Michael Dammann, Technischer Geschäftsführer, Gasnetz Hamburg: „Mit der Rückkehr der Energienetze in städtische Hand hat Hamburg den Weg für die städtische Energiewende geebnet. Projekte wie die integrierte Netzplanung versammeln die relevanten Akteure hinter einem Ziel. Wir betrachten Gas, Strom und Wärme als integriertes System und könne so für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt klimafreundliche und zugleich volkswirtschaftlich sinnvolle Versorgungslösungen schaffen. Für die Dekarbonisierung der Industrie mit Wasserstoff hat Gasnetz Hamburg mit dem städtischen Eigentürmer einen starken politischen Rückhalt. So leistet unser Unternehmen einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz in Hamburg.“
Eine Vorbildfunktion für die Daseinsvorsorge
Die Rekommunalisierung der Energienetze in Hamburg ist ein Vorbild für eine gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge. Dieses Modell fördert nicht nur die effektive Umsetzung öffentlicher Aufgaben, sondern unterstützt zudem die Verwirklichung wichtiger klimapolitischer Ziele.Durch die Rekommunalisierung behält die Stadt die Kontrolle über die Wertschöpfung und gewährleistet dadurch ihre Ausrichtung am Gemeinwohl. Zudem bietet ein städtischer Fernwärmeanbieter einen wirkungsvollen Schutz vor Preisübertreibungen, da er nicht auf Gewinnmaximierung aus ist. Darüber hinaus ergeben sich sinnvolle Synergien mit weiteren öffentlichen Unternehmen.
Erfolgsbeispiele
In den vergangenen zehn Jahren nach dem Netzerückkauf haben die städtischen Energiegesellschaften Stromnetz Hamburg (SNH), Gasnetz Hamburg (GNH) und die Hamburger Energiewerke (HEnW) beeindruckende Erfolge erzielt. Die Transformation für ein nachhaltiges Energieinfrastruktursystem wurde eingeleitet, die Förderung erneuerbarer Energien intensiviert und öffentliche Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität etabliert.. Zusammen haben diese Unternehmen die Versorgungssicherheit während der Energiekrise des letzten Jahres gewährleistet, gemeinsam die integrierte Netzentwicklungsplanung (iNEP) und mit dem Energiepark Hafen ein zentrales Projekt zum Kohleausstieg in Hamburg vorangetrieben.
SNH hat sich als Vorreiter im Carve-out-Prozess aus dem Vattenfall-Konzern etabliert und erfolgreich Netzservice, Metering und DSO zu einem großen Verteilungsnetzbetreiber fusioniert. Zusätzlich hat SNH in intelligente Stromnetztechnologien investiert und unterstützt die Mobilitätsstrategie der Stadt durch den Ausbau von öffentlichen Ladestationen und Landstromanschlüssen für Schiffe. GNH spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Wasserstoff-Industrie-Netzes HH-WIN und unterstützt so die Dekarbonisierung der Hamburger Industrie. HEnW treiben die Transformation der Fernwärme, den Kohleausstieg bis 2030 und den Ausbau erneuerbarer Energien in der Stadt aktiv voran. Projekte wie die Nutzung von Geothermie in Wilhelmsburg, die Integration von Abwärme aus Aurubis oder die Nutzung von Abwasserwärme aus dem Klärwerk Dradenau haben dabei deutschland- und europaweite Strahlkraft.