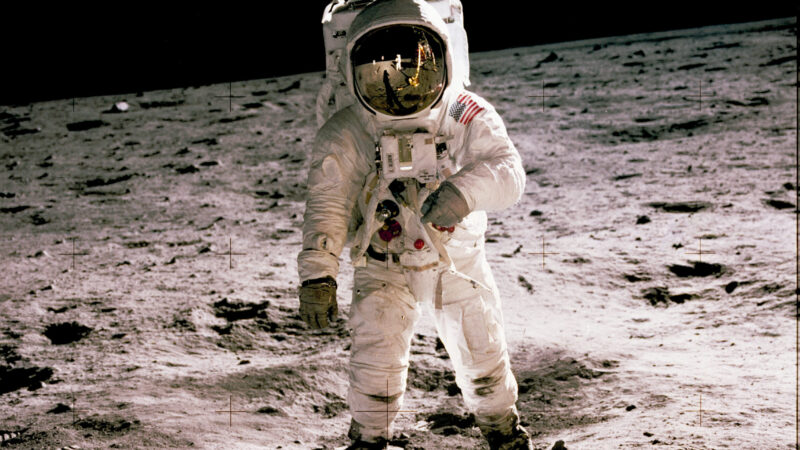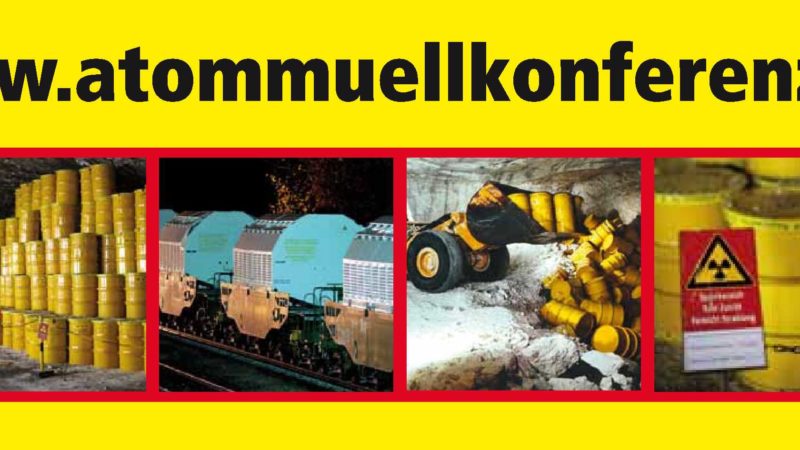Offener Brief: Bundesamt genehmigt Sicherheitsabbau in Biblis bei der Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle

(Sellafield, Wiederaufarbeitung, Castortransporte, Biblis Zwischenlager) Das „Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE)“ (bislang BfE) hat wenige Tage vor Weihnachten 2019 die Einlagerung von in Glas eingeschmolzenem und in Kokillen gefülltem hochradioaktivem Atommüll in das Standortzwischenlager Biblis genehmigt und die Genehmigung Mitte Januar 2020 online veröffentlicht. Im Folgenden soll diese Genehmigung bezogen auf diese besonderen radioaktiven Abfälle betrachtet und überblicksartig bewertet werden. UmweltFAIRaendern stützt sich dabei auf einen „Offenen Brief“ des Physikers Wolfgang Neumann (ehemals intac) an die Genehmigungsbehörde BASE und an die zuständige Atomaufsicht in Hessen. Nicht weiter behandelt werden die sicherheitstechnisch überaus relevanten Fragen hinsichtlich der wachsenden Anforderungen an den Terrorschutz (insbesondere Flugzeugabsturz, Beschuss mit panzerbrechenden Waffen, Angriff mit Sprengmitteln) oder auch wachsenden Sicherheitsanforderungen aufgrund einer langfristigen Zwischenlagerung über die derzeit genehmigten 40 Jahre hinaus (Stichwort Endlagersuche). (Bitte beachten: Ganz unten gibt es weitere Informationen zum Thema: Was tun wenn der Castor undicht wird!)
Update 18022020: BUND Hessen widerspricht der Einlagerung von Sellafield-Castoren in das Standort-Zwischenlager des AKW Biblis
- Der Offene Brief zur Einlagerungs-Genehmigung für HAW-WAA-Abfälle in das Zwischenlager Biblis (PDF) von Wolfgang Neumann (Physiker, ehemals intac) an BASE
- Radioaktive Castortransporte: Bundesamt veröffentlicht Genehmigung für Zwischenlager Biblis
- Hochradioaktiver Atommüll zum Zwischenlager Biblis: Transportgenehmigung über deutschen Hafen erteilt
Grundsätzlich steht die Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle auf dem Prüfstand, das hatten Umweltverbände und Anti-Atom-Gruppen zuletzt in diesem Positionspapier verdeutlicht. Dies wurde auch schon in wissenschaftlichen Fachbeiträgen erörtert (siehe z.B. Problem Atommüll: Entria und die Zwischenlagerung hoch radioaktiver Abfälle – Randbedingungen und Lösungsansätze).
Zur Biblis-Genehmigung in einem Satz: Die jetzt vorliegende Genehmigung für die Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle kommt einem Abbau des Sicherheitsniveaus gleich, wie er auch für andere Zwischenlager zu beobachten ist (z.B. Jülich, Brunsbüttel).
- Siehe auch diese beiden gutachterlichen Stellungnahmen von Wolfgang Neumann im Auftrag von Greenpeace: „Zur Notwendigkeit von Heißen Zellen an Zwischenlagerstandorten“ (PDF) und außerdem als Reaktion auf die unten genannte ESK-Stellungnahme: „Zwischenlagerung von CASTOR® HAW 28M – Ergänzung zur Studie Zur Notwendigkeit von Heißen Zellen an Zwischenlagerstandorten“ (PDF)
Das Genehmigungsverfahren wurde komplett ohne atomrechtliche Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Trotz gegenteiliger Vorschläge im Rahmen des NBG (Siehe dazu z.B. Hagedorn/Gassner hier: Mehr Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Zwischenlagerung mit Terror-Schutz-Sonderbeauftragtem und hier: Atommüll-Zwischenlagerung: Von Sicherheit, Öffentlichkeitsbeteiligung und Kritik) und aller Transparenz- und Beteiligungsrhetorik von Vertretern der Bundesregierung und der Leitung des BASE. Dabei hätte die Genehmigungsbehörde dazu die Möglichkeit gehabt, denn im Unterschied zu den bislang genehmigten radioaktiven Abfällen in Form von bestrahlten Brennelementen aus den Reaktorblöcken Biblis A und B wird an diesem Standort nun erstmals in Glas eingeschmolzener Abfall zur Zwischenlagerung genehmigt. Diese Abfälle stellen in mehreren Punkten andere Anforderungen bzw. bringen andere Probleme mit sich, als bestrahlte Brennelemente (siehe z.B. hier: Wolfgang Neumann, 2016, PDF).
Deshalb gibt es auch neuartige Sicherheitsanforderungen:
- In Bezug auf die Wiederaufarbeitungsabfälle selber sind andere Störfallabläufe möglich als für bestrahlte Brennelemente. Das heißt, das Verhalten der Abfälle müsste neu bewertet werden.
- Für die Zwischenlagerung dieser Wiederaufarbeitungsabfälle wird ein andersartiger Behälter eingesetzt, der CASTOR HAW 28M. Er unterscheidet sich in wichtigen Merkmalen von den bisher eingesetzten Behältern für bestrahlte Brennelemente. Unter anderem deshalb sind auch die Transportbedingungen unterschiedlich. Der CASTOR HAW 28M darf nur mit intakter Primärdeckeldichtung transportiert werden, während bei den Behältern für Brennelemente auch ein intakter Sekundärdeckel reicht. Dies hat wiederum zur Folge, dass eine Heiße Zelle für den Fall des Primärdeckelversagens eigentlich unumgänglich ist.
Allein diese grundlegenden Sicherheitsfragen hätten es zwingend erforderlich gemacht, ein atomrechtliches Genehmigungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Das ist von BfE/BASE abgelehnt worden. Auch ohne UVP hätte eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden können. Sie ist in diesem Fall zwar nicht zwingend vorgeschrieben, hätte aber im Ermessen der Genehmigungsbehörde gelegen (siehe VGH Mannheim 2014 zur nicht erfolgten Öffentlichkeitsbeteiligung zur 2. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für das AKW Obrigheim). Gerade wegen der häufig aus dem Haus der Genehmigungsbehörde propagierten Transparenz und Beteiligungskultur wäre eine entsprechende Ermessensausübung zu erwarten gewesen.
Die nun seit Mitte Januar 2020 öffentlich zugängliche Genehmigung zum Standort-Zwischenlager Biblis, die bereits wenige Tage vor Weihnachten 2019 erteilt worden war, enthält mehrere Sicherheitsmängel, die die Sicherheit der Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle selbst gegenüber dem gegenwärtigen Stand noch verringern.
Mit Provisorien, Hilfskonstruktionen, später erhofften Sicherheitsnachweisen und Wahrscheinlichkeitsdeutereien erteilt BASE auf fragwürdigen Grundlagen die Genehmigung für die Zwischenlagerung hochradioaktiver verglaster Atomabfälle in CASTOR HAW 28M im Zwischenlager Biblis. Das kann eigentlich nur als Verzweiflungstat aufgrund der jahrelang versäumten sicherheitstechnischen Vorbereitung für die Rücknahme der Wiederaufarbeitungsabfälle angesehen werden. Eine angemessene Schadensvorsorge nach Atomgesetz sieht anders aus.
Die gravierendsten Sicherheitsmängel in der Genehmigung des BASE für die Zwischenlagerung hoch radioaktiver Abfälle in Biblis sind (siehe z.B. hier: Wolfgang Neumann, 2016, PDF):
- Keine Heiße Zelle zur Reparatur bei Primärdeckelundichtheit.
- Sollten bestimmte Umstände eine Auslagerung aller Behälter verlangen, könnten CASTOR® HAW 28M ohne Primärdeckeldichtheit nicht nach den atomrechtlichen Vorschriften abtransportiert werden.
- Selbst Anforderungen der ESK zum Stand der Möglichkeiten zum Umgang mit defekten Primärdeckeldichtungen werden nicht eingehalten.
- Es wird ein zusätzlicher Rabatt für die Sicherheit des Deckel- und Dichtungssystems für den Behältertyp CASTOR HAW 28M gewährt (Stichwort: Klemmringkonstruktion).
- Die Störfallanalyse für die Zwischenlagerung von CASTOR HAW 28M ist wegen des Ausschlusses bestimmter Abläufe vor allem beim Abfallverhalten sicherheitstechnisch unzureichend.
- Trotz der Tatsache, dass es in den nächsten 40 Jahren keine Möglichkeit geben wird die Behälter in ein Endlager zu bringen, wird die Genehmigung auf diesen Zeitraum begrenzt. Motto offenbar: „Nach mir die Sintflut“.
- Trotz gravierend unterschiedlicher Behälter und Behälterinventare wurde keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.
Fazit: Unter Grüner Behördenleitung wird die sicherheitstechnische Schadensvorsorge bei der Zwischenlagerung mit der 9. Änderungsgenehmigung für das Standort-Zwischenlager Biblis weiter abgeschwächt. Auch die in Sonntagsreden von BehördenvertreterInnen viel betonte Transparenz und Beteiligungskultur findet sich in diesem Genehmigungsverfahren nicht wieder. Kein Wunder, eine Bundesbehörde erteilt einer bundeseigenen Gesellschaft eine Genehmigung.
Was tun, wenn der Castor undicht wird? Wie umgehen mit Primärdeckeldichtheitsverlust?
Die beste Option, wenn es zu einem Deckelversagen bei einem CASTOR-Behälter mit hochradioaktiven Abfällen oder bestrahlten Brennelementen kommt: Im oder neben dem Zwischenlager gib es eine Heiße Zelle, in der hinter dicken Betonwänden abgeschirmt mit optimaler Abluftfilterung und fernhantiert die Primärdeckeldichtung ausgetauscht wird. Im Falle weitergehender Schäden kann der Inhalt eines CASTOR-Behälters komplett in einen anderen Behälter umgeladen werden. Eine solche Heiße Zelle ist jedoch aufwendig und kostspielig. Daher versuchen Genehmigungsbehörden und Betreiber andere Wege zu finden, mit einem Dichtungsversagen umzugehen. So hatte die Entsorgungskommission (ESK) der Bundesregierung 2014 Vorschläge vorgelegt. Diese waren als nicht ausreichend kritisiert worden – siehe dazu die folgenden Links, in denen auch weitere Gutachten von Wolfgang Neumann vorgestellt und dokumentiert werden:
- Undichte Castor-Behälter: Neue Studie zur Sicherheit der Atommülllagerung fordert Heiße Zellen
- Atommüll-Zwischenlager brauchen Nachrüstung: Heiße Zellen sind erforderlich
- Atommüll-Zwischenlagerung: Von Sicherheit, Öffentlichkeitsbeteiligung und Kritik
- Dokumentation: „Stellungnahme zur Pilot-Konditionierungsanlage Gorleben“, 2015
- Hochradioaktiver Atommüll: Wie lange hält der Castor dicht? USA haben nachgesehen
- Atommüllkonferenz: Auf dem Prüfstand – Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle und der Strahlenschutz
- Hochradioaktiver Atommüll: Zwischenlagerung auf dem Prüfstand