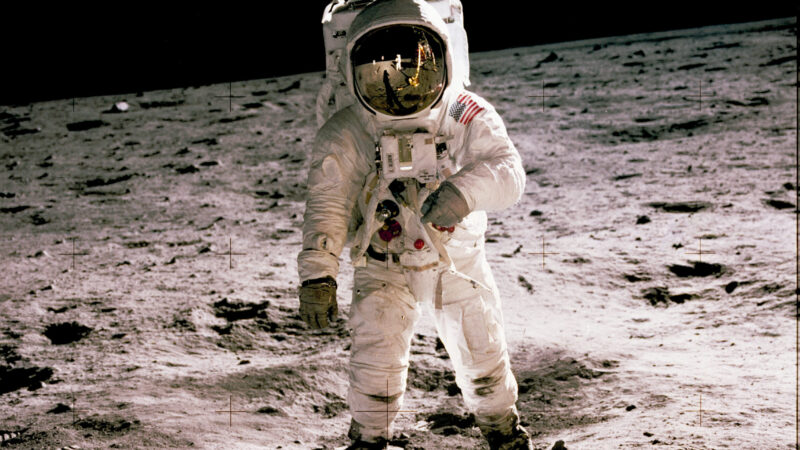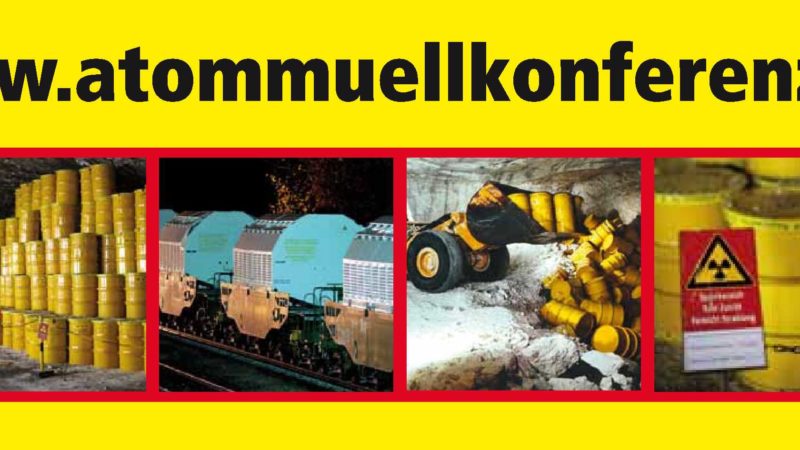Atomenergie: Bundesamt legt Studie zu alternativen Reaktorkonzepten vor – Nicht verfügbar – Keine Hilfe beim Klimaschutz

Während international trotz enormer Kosten und Sicherheitsrisiken für die Atomenergie mobilisiert wird, hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BaSE) ein Update seiner Studie zu alternativen Reaktorkonzepten vorgelegt. Medien erzeugen immer wieder den Eindruck, als seinen neue Reaktorkonzepte kurz vor einem weltweiten Einsatz. Doch tatsächlich sind fast alle diese Modelle noch im Entwicklungsstation, oftmals erst im Bereich der Konzeptentwicklung. Vielfach sind hohe technische Anforderungen noch ungelöst und oftmals geraten schnell die Kosten außer Kontrolle. Nicht wirtschaftliche oder politische Interessensvertreter:innen, sondern wissenschaftliche Untersuchungen und Expertise trägt BaSE zusammen. „Die wissenschaftliche Studie kommt zu dem Schluss, dass bei diesen Konzepten weiterhin zahlreiche sicherheitstechnische und ökonomische Fragestellungen offen sind. Sie werden bis zur Mitte dieses Jahrhunderts nicht in relevantem Umfang zum Einsatz kommen“, heißt es zu der neuen Veröffentlichung.
- Neue Atomreaktoren? Formulierte Erwartungen können “insgesamt nicht als realistisch eingeschätzt werden” stellt neue Studie fest
- DIW legt Studie vor: Atomenergie ist nicht nachhaltig und zukunftungsfähig – Es braucht Klima- und Plutoniumneutralität!
- Was ist dran an kleinen Atomreaktoren? Kurzer Faktenscheck über neue nukleare Heilsbringer
- Ohne Zukunft: Atomkraft löst keine Probleme – sondern verschärft sie
- Alles über SMR (Small Modular Reactors) auf umweltFAIRaendern.
- Die Studie ist hier als Langfassung und hier als Kurzfassung direkt online (PDF).
Zwei DOKUMENTATION von der Seite beim BaSE vom 21. März 2024
1. PM: BASE-Studie: Alternative Reaktorkonzepte lösen das Endlagerproblem nicht
Eine neue wissenschaftliche Studie im Auftrag des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) zeigt: Die Markteinführung von alternativen Reaktorkonzepten (auch als „Generation IV“ bezeichnet) ist aktuell nicht absehbar. „Trotz teils intensiver Werbung von Herstellern sehen wir derzeit keine Entwicklung, die den Bau von alternativen Reaktortypen in den kommenden Jahren in großem Maßstab wahrscheinlich macht. Im Gegenteil: Wir müssen erwarten, dass aus sicherheitstechnischer Sicht die möglichen Vorteile dieser Reaktorkonzepte von Nachteilen und den nach wie vor ungeklärten Fragen überwogen werden“, sagt BASE-Präsident Christian Kühn und betont: „Die Konzepte lösen weder die Notwendigkeit, ein Endlager für die radioaktiven Abfälle zu finden, noch die drängenden Fragen des Klimaschutzes.“
Die alternativen Reaktorkonzepte, darunter auch SMR, werden zudem häufig mit der Hoffnung verknüpft, dass damit Sicherheitsrisiken und Entsorgungsprobleme der Kernkraft vermindert oder gar gelöst werden könnten. Um dies zu überprüfen, hat das BASE die Studie „Analyse und Bewertung des Entwicklungsstands, der Sicherheit und des regulatorischen Rahmens für sogenannte neuartige Reaktorkonzepte“ in Auftrag gegeben. Die wissenschaftliche Arbeit wurde vom Öko-Institut, der Technischen Universität Berlin sowie dem Physikerbüro Bremen durchgeführt.
„Kein alternativer Reaktortyp würde ein Endlager überflüssig machen“
Dazu wurden sieben international seit vielen Jahren diskutierte Technologielinien für alternative Reaktorkonzepte untersucht, die zuweilen auch als „Reaktoren der vierten Generation“ bezeichnet werden. Mit darunter sind beispielsweise die sogenannten blei- und gasgekühlten Reaktoren, Salzschmelzereaktoren oder beschleunigergetriebene Systeme. „Wer heute Euphorien in Verbindung mit alternativen Reaktorkonzepten weckt, blendet offene Fragen und Sicherheitsrisiken aus. Im Hinblick auf die Sicherheit der nuklearen Entsorgung bleibt festzuhalten, dass kein alternativer Reaktortyp den Bau eines Endlagers überflüssig macht“, betont BASE-Präsident Kühn.
Nach Ansicht ihrer Entwickler sollen die Reaktoren der IV. Generation gegenüber heutigen Kernkraftwerken Vorteile bei der Brennstoffausnutzung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit sowie nuklearer Nichtverbreitung (Non-Proliferation) bieten. Ein weiterer Vorteil soll darin liegen, dass weniger hochradioaktive Abfälle entstehen oder gar bestehende Abfälle mit diesen Reaktoren entsorgt werden können.
Die in der Studie untersuchten Reaktorkonzepte wurden bzgl. ihrer Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Proliferationsresistenz oder des Brennstoffverbrauchs verglichen. „Einzelne Technologielinien könnten – bei konsequenter Auslegung – in einzelnen der Kriterien potenzielle Vorteile gegenüber heutigen Leichtwasserreaktoren erzielen. Aber für keine der Technologielinien ist in allen Bereichen ein Vorteil zu erwarten, in einzelnen Bereichen sind auch Nachteile gegenüber heutigen Leichtwasserreaktoren möglich“, sagt Christoph Pistner vom Öko-Institut.
Eine Betrachtung von sechs Ländern ergab: „Auch im internationalen Kontext stellen die alternativen Reaktorkonzepte weder den bisherigen Trend zu Leichtwasserreaktoren in Frage, noch stellen sie eine machbare, wirtschaftliche Option für zukünftige Energieversorgung dar“, sagt Christian von Hirschhausen von der TU Berlin. „Dies wird in der Studie anhand von sechs ausführlichen Länderstudien (USA, Russland, China, Südkorea, Polen, Belgien) ausgeführt. Insbesondere die USA, von denen in der öffentlichen Diskussion häufig die Rede ist, hat bei der Entwicklung von nicht-Leichtwasserreaktoren keine Durchbrüche erzielt bzw. sogar angekündigte Inventionen wieder zurückgenommen („Traveling Wave Reactor“).“
Resultate der Studie
Das vom BASE geförderte Forschungsvorhaben kommt zu folgenden Schlüssen:
- Entwicklungsstand: Alle derzeit unter dem Stichwort „Generation IV“ diskutierten Konzepte sind seit Jahrzehnten, teilweise seit den 1950er Jahren in Entwicklung und konnten bisher keine Marktreife erreichen. Nach wie vor bestehen erhebliche Forschungs- und Entwicklungsbedarfe. Falls die technischen Hürden sowie Sicherheitsfragen gelöst werden können, würde der weitere Zeitbedarf für die Entwicklung wahrscheinlich im Bereich von mehreren Jahrzehnten liegen. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass solche Reaktorkonzepte bis zur Mitte dieses Jahrhunderts in relevantem Umfang zum Einsatz kommen werden. Insbesondere zeigen einzelne Länderstudien, dass ein Systemwechsel von Leichtwasserreaktoren zu serienreifen alternativen Reaktorkonzepten nicht absehbar ist.
- Abfallaufkommen: Die alternativen Reaktoren würden weiterhin hochradioaktive Abfälle erzeugen, die sich teilweise deutlich von den Abfällen der Leichtwasserreaktoren unterscheiden, beispielsweise weil sie nicht als feste Brennelemente sondern als Salzschmelze vorliegen. Die Abfallbehandlung wäre dabei deutlich erschwert, da heutige Endlagerplanungen in aller Regel nicht auf diese Abfälle ausgelegt sind. Das Volumen der hochradioaktiven Abfälle könnte in Verbindung mit der Wiederaufbereitungstechnologien zwar reduziert werden, das Aufkommen an mittel- und schwachradioaktiven Abfällen würde sich aber deutlich erhöhen.
- Transmutationseigenschaften: Einzelne der untersuchten Reaktorkonzepte könnten theoretisch genutzt werden, um einzelne Teile der bestehenden hochradioaktiven Abfälle zu spalten (transmutieren). Dies wäre mit einem hohen Aufwand über einen langen Zeitraum verbunden. Diese Maßnahmen würden absehbar jedoch nur einen vergleichsweise geringen Beitrag zur Reduktion des Flächenbedarfs eines Endlagers oder zu dessen Langzeitsicherheit leisten. Dies liegt insbesondere daran, dass die Stoffe, die den größten Einfluss auf die Sicherheit haben (langlebige Spaltprodukte) sich nur schlecht transmutieren lassen und daher nicht dafür vorgesehen werden.
- Regelwerk: Die untersuchten Regelwerke internationaler Organisationen (bspw. IAEA) und nationalen Regelwerke (USA, Kanada und V.K.) machen teilweise sehr konkrete, technologie-spezifische Vorgaben, die auf jahrzehntelanger Betriebserfahrung mit Leichtwasserreaktoren aufbauen. Diese Regelwerke sind daher nicht direkt auf die untersuchten, alternativen Reaktorkonzepte anwendbar. Aktuell finden Überarbeitungen statt, allerdings ist aufgrund einer deutlich geringeren Betriebserfahrung von einem erheblichen Zeitbedarf auszugehen, bis ein ähnlich fundiertes Regelwerk vorliegt.
Fazit: Die in der öffentlichen Diskussion und von Entwicklern formulierte Erwartung, dass die alternativen Reaktorkonzepte einen signifikanten Beitrag zur Lösung der heutigen Probleme der Kerntechnik betragen können, kann angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstandes dieser Systeme und der tatsächlich nachgewiesenen und erwartbaren Vor- aber auch Nachteile der einzelnen Technologielinien damit insgesamt nicht als realistisch eingeschätzt werden.
2. Studie zu alternativen Reaktorkonzepten
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts werden Reaktorkonzepte erforscht, die sich von Leichtwasserreaktoren teils signifikant unterscheiden. Diese sollen laut den Entwickler:innen Vorteile gegenüber heute weit verbreiteten Leichtwasserreaktoren aufweisen. Die wissenschaftliche Studie kommt zu dem Schluss, dass bei diesen Konzepten weiterhin zahlreiche sicherheitstechnische und ökonomische Fragestellungen offen sind. Sie werden bis zur Mitte dieses Jahrhunderts nicht in relevantem Umfang zum Einsatz kommen.
International werden seit Jahrzehnten alternative Reaktorkonzepte diskutiert, erforscht und entwickelt. Sie sollen als Lösungsstrategie zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung sowie teilweise auch der Wärmeversorgung für den Industrie- und Wohnsektor beitragen.
Studie: „Analyse und Bewertung des Entwicklungsstandards, der Sicherheit und des regulatorischen Rahmens für sogenannte neuartige Reaktorkonzepte“
Im Auftrag des BASE wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens aktuelle Entwicklungen von solchen Reaktorkonzepten, die sich wesentlich von Leichtwasserreaktoren unterscheiden, untersucht. Die Unterschiede finden sich meist bei Kühlmittel, Moderator, Neutronenspektrum sowie Art und Form des Brennstoffs.
Die untersuchten Konzepte sind:
- Natriumgekühlte Schnelle Reaktoren (Sodium-cooled Fast Reactor, SFR)
- Bleigekühlte Schnelle Reaktoren (Lead-cooled Fast Reactor, LFR)
- Gasgekühlte Schnelle Reaktoren (Gas-cooled Fast Reactor, GFR)
- Salzschmelzereaktoren (Molten Salt Reactor, MSR)
- Mit superkritischem Wasser gekühlte Reaktoren (Supercritical-water-cooled Reactor, SCWR)
- Hochtemperaturreaktoren (Very High Temperature Reactor, VHTR)
- Beschleunigergetriebene Systeme (ADS)
Die ersten sechs Reaktorkonzepte werden teilweise auch als „Generation IV“-Konzepte bezeichnet, da sie von dem sogenannten „Generation IV International Forum“ (GIF) mitentwickelt werden. Bei dem GIF handelt es sich um einen 2001 gegründeten, internationalen Verbund von Staaten und Industrieunternehmen, welche die Entwicklung der entsprechenden Reaktorkonzepte voranzutreiben versuchen.
Studie betrachtet Sicherheit der Reaktorkonzepte und Entsorgungsfrage
Die untersuchten Konzepte wurden anhand der Kriterien des technologischen Entwicklungsstands, der Sicherheit, Ver- und Entsorgungsfragen, Proliferationsrisiken und der erwarteten Kosten bewertet. Die Studie kommt zum Ergebnis:
- In manchen Kategorien weisen die untersuchten Reaktorkonzepte Vorteile gegenüber Leichtwasserreaktoren auf. Es ist aber nicht zu erwarten, dass eines der Konzepte in allen Bereichen Vorteile aufweisen wird. In einzelnen Bereichen sind auch Nachteile gegenüber heutigen Leichtwasserreaktoren absehbar.
- Einige Reaktorkonzepte werfen neue sicherheitstechnische Fragestellungen auf. Beispielsweise die Möglichkeit von Kühlmittelbränden bei natriumgekühlten Reaktoren, ein verstärktes Auftreten von Korrosion bei Salzschmelzereaktoren oder eine schwierigere Regelbarkeit des Reaktors aufgrund einer anspruchsvolleren Neutronenphysik bei schnellen Reaktoren, bedingt durch einen geringeren Anteil verzögerter Neutronen.
- Trotz der Tatsache, dass die Reaktorkonzepte teils seit Jahrzehnten in Entwicklung sind, existiert bis heute kein kommerziell konkurrenzfähiges Reaktorkonzept. Der weitere Zeitbedarf für die Entwicklung der untersuchten Konzepte wird im Bereich von mehreren Jahrzehnten gesehen.
- Teilweise könnten die untersuchten Konzepte Kostenvorteile gegenüber Leichtwasserreaktoren aufweisen. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Kostenvorteile die bisherigen Kostennachteile heutiger Leichtwasserreaktoren gegenüber anderen Stromerzeugungstechnologien, insbesondere erneuerbaren Energien, ausgleichen oder gar in einen Kostenvorteil umkehren könnten.
In Summe geht die Studie davon aus, dass die untersuchten Konzepte bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts nicht im relevanten Umfang zum Einsatz kommen werden.
Einfluss alternativer Reaktorkonzepte auf radioaktive Abfallmengen
Das Vorhaben untersuchte, in welchem Umfang alternative Reaktorkonzepte radioaktive Abfälle erzeugen oder sogar reduzieren können und wie sich diese Abfälle von jenen aus Leichtwasserreaktoren unterscheiden. Diese Fragen lassen sich jedoch nicht pauschal beantworten. Das liegt zum einen daran, dass sich die Technologien noch in der Entwicklung befinden und zum anderem daran, dass dies maßgeblich davon abhängt, in welches System aus Kernkraftwerken die alternativen Reaktorkonzepte integriert werden. Beispielsweise ob eine Wiederaufbereitung angedacht ist.
Eigenschaften der AbfälleEinklappen / Ausklappen
Heutige Leichtwasserreaktoren nutzen hauptsächlich Uranoxid-Brennelemente. Diese werden nach der Nutzung aus dem Reaktor entnommen und erst zwischen- und dann endgelagert. Als Kühlmittel und Moderator kommt Wasser zum Einsatz. Einige der alternativen Reaktorkonzepte sollen andere Brennstoffe, Kühlmittel und Moderatoren verwenden. Dies hat einen Einfluss auf die entstehenden Abfälle. Nachfolgend werden exemplarisch einige der Herausforderungen dargestellt.
Brennstoff
SFR, LFR, SCWR, GFR und ADS werden, wie Leichtwasserreaktoren auch, feste Brennelemente nutzen. Sie haben allerdings einen höheren Abbrand als Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren, das heißt, pro Masse finden mehr Kernspaltungen statt. Aufgrund dieses höheren Abbrands werden die abgebrannten Brennelemente aus den alternativen Reaktorkonzepten absehbar ein höheres Strahlungsniveau haben und mehr Wärme freisetzen. Dies erschwert den Umgang.
Bei den meisten Konzepten für Flüssigsalzreaktoren (MSR) liegt der Brennstoff nicht in fester Form, sondern als flüssige Salzschmelze vor. Diese Salzschmelzen weisen eine höhere Wasserlöslichkeit auf, was die Endlagerung erschwert. Aus diesem Grund müssen Verfahren entwickelt werden, um die Abfälle so aufzubereiten, dass ihre Mobilität im Erdreich reduziert ist .
Hochtemperaturreaktoren (VHTR) nutzen sogenannte TRISO-Partikel. Dabei handelt es sich um kleine Brennstoffkugeln mit einem Durchmesser von ungefähr 1 mm, die von mehreren dünnen Schutzschichten umgeben sind. Eine Vielzahl von TRISO-Brennstoffpartikeln ist dann in einer Graphitmatrix eingebettet. Diskutiert werden Graphitmatrizen in Kugelform (etwa in der Größe eines Tennisballs) oder in Form eines Prismas. Die Graphitmatrix führt zu einem deutlich höheren Abfallvolumen als bei Leichtwasserreaktoren. Am wahrscheinlichsten ist die direkte Endlagerung des Gebindes aus Graphitmatrix und TRISO-Partikeln. Hierfür braucht es ein geeignetes Konditionierungsverfahren, untersucht werden hier beispielsweise die Zementierung oder Sandverfüllung.
Kühlmittel
Während Leichtwasserreaktoren Wasser als Kühlmittel nutzen, kommen bei alternativen Reaktorkonzepten teilweise andere Kühlmittel zum Einsatz. Beispielsweise Natrium (SFR) oder Blei (LFR). Diese müssen aufgrund der Aktivierung bzw. Kontaminierung mit Radionukliden ebenfalls einer Endlagerung zugeführt werden. Das Natrium beispielsweise enthält eine Reihe von Aktivierungsprodukten wie Na-22 oder Co-60 (aus der Stahlstruktur) sowie Kontaminationen durch Spaltprodukte und Aktiniden. Weitere Herausforderungen resultieren aus den chemischen Eigenschaften der Kühlmittel, Natrium ist beispielsweise brennbar.
Moderator
Die meisten alternativen Reaktorkonzepte nutzen ein schnelles Neutronenspektrum. Das heißt, es braucht keinen Moderator, der die Neutronen von einem schnellen zu einem thermischen Neutronenspektrum abbremst. Beim thermischen Salzschmelzereaktor und beim VHTR kommt jedoch Graphit als Moderator zum Einsatz. Dabei bildet sich u. a. das langlebige und biologisch wirksame radioaktive Isotop Kohlenstoff-14. Der Graphit muss daher ebenfalls entsorgt werden. Ggf. kann dies gemeinsam mit dem Brennstoff erfolgen.
Fazit
In Summe lässt sich festhalten, dass sich durch den Einsatz alternativer Reaktorkonzepte neue Fragestellungen für die Entsorgung der entstehenden Abfälle ergeben, für die noch keine Lösungen gefunden wurden. Ein Beispiel hierfür ist das Molten Salt Reactor Experiment von 1965 bis 1969 in den USA. Seit der Abschaltung befindet sich das Reaktorgebäude in unverändertem Zustand, die Salzschmelze befindet sich noch in erstarrter Form im Reaktor, da die Frage der Entsorgung noch nicht geklärt ist.
AbfallmengenEinklappen / Ausklappen
Zur Frage, wie sich der Einsatz alternativer Reaktorkonzepte auf die Abfallmengen auswirken könnte, wurden bestehende Untersuchungen ausgewertet. Diese kommen zum Ergebnis, dass es möglich sein könnte, die anfallende Masse hochradioaktiver Abfälle pro erzeugter Energiemenge deutlich (bis zum Faktor 37) zu reduzieren. Dieser Effekt ist aber hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Uran 238 – dieses ist der Hauptbestandteil des hochradioaktiven Abfalls – abgetrennt und als schwach- und mittelradioaktiver Abfall bewertet wird.
Die Größe eines Endlagers, bzw. der Platzbedarf für die Einlagerung, und damit die Höhe der Kosten werden wesentlich bestimmt durch das Gesamtvolumen der Abfälle und deren Wärmeleistung. Die Analyse der bestehenden Untersuchungen zeigt, dass beim Einsatz alternativer Reaktorkonzepte die Reduzierung der Abfallvolumina deutlich geringer ausfällt: Abfallvolumina ließen sich nur auf ungefähr ein Drittel reduzieren. Der Grund für die geringere Reduzierung ist, dass die Abwärme dieser Abfälle pro Masse deutlich höher ist. Die Abfälle können daher weniger dicht gepackt werden.
Berücksichtigt man nicht nur hochradioaktive sondern auch schwach- und mittelradioaktive Abfälle, fallen in allen untersuchten Szenarien mit alternativen Reaktorkonzepten deutlich höhere Abfallvolumina an.
Entwicklungsstand der Reaktorkonzepte in anderen Ländern
Die Studie untersuchte auch die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zu den Reaktorkonzepten im Ausland. Die Auswertung ausgewählter Länder ergab, dass neben dem (fraglichen) Ziel einer günstigen Erzeugung von Strom (und ggf. Wärme) folgende Motive vorhanden sind:
- Geopolitischer Einfluss (beispielsweise die Möglichkeit durch Exporte Einfluss auf die Atom-Programme anderer Länder zu nehmen),
- Nutzung von Synergien mit militärischen Atom-Programmen,
- Aufrechterhaltung von Wissen und industriellen Kapazitäten im Bereich der Kernenergie,
- die Dekarbonisierung des Energiesystems,
- die Entwicklung eines sogenannten geschlossenen Brennstoffkreislaufs; also der Möglichkeit durch Wiederaufbereitung einen Teil der Abfälle aus Leichtwasserreaktoren zu nutzen oder neuen Brennstoff für Leichtwasserreaktoren zu erbrüten.
Im Rahmen der Studie wurden die Forschungsaktivitäten der USA, Chinas, Russlands (Staaten mit Atomwaffen und Atomkraftwerken), Südkoreas und Belgiens (Staaten mit Atomkraftwerken aber ohne Atomwaffen) sowie Polen (ein potentielles Einstiegsland in die Atomenergie) auf dem Gebiet von alternativen Reaktorkonzepten vertieft analysiert.
USA
Die USA waren seit den 1950er Jahren durch das Manhattan-Projekt weltweit führend in der Entwicklung von Reaktortechnologien. Jedoch erfolgte die erfolgreiche Vermarktung, sowohl in den USA als auch international, lediglich bei Leichtwasserreaktoren und nicht – wie ursprünglich erwartet – auch in den anderen Technologielinien. Mit der weitgehenden Einstellung von Aufträgen für den Bau von Leichtwasserreaktoren seit den 1980er Jahren befindet sich die US-Atomkraftwerkstechnik im Rückgang, den auch das Energiegesetz von 2005 bisher nicht aufgehalten hat. Die seit ca. zehn Jahren beobachteten Aktivitäten zur Förderung sowohl von Leichtwasserreaktoren mit geringen Leistungen (SMR-Konzepte) als auch von alternativen Reaktorkonzepten, sind ein Versuch, für die US-Kernkraftwerkstechnik wieder einen Anspruch auf internationale Technologieführerschaft zu entwickeln. Derzeit ist kein kommerzieller Durchbruch abzusehen.
Russland
In Russland lag in der Anfangszeit der kerntechnischen Entwicklung der Schwerpunkt bei Reaktoren mit schnellem Neutronenspektrum (SFR, später auch LFR) in Verbindung mit Wiederaufarbeitung (Mayak, Pilotanalage sowie Brennelemente-Fabrik Uran–Plutonium-Mischoxidbrennstoffe in Zheleznogorsk). In der Folge wurde dieser Schwerpunkt vertieft (BN-600, BN-800). Aktuell befindet sich das russische Innovationssystem bzgl. alternativer Reaktorkonzepte in einer Phase, in der die Forschungsinfrastruktur älter wird (BOR-60, seit 1969 in Betrieb) und Projekte aufgeschoben werden (z. B. BN-1200), derzeit wird der BREST-OD-300 priorisiert. Russland hält an der Langzeitstrategie fest, einen sogenannten geschlossen Brennstoffkreislauf mit Hilfe von Reaktoren mit schnellem Neutronenspektrum zu erreichen und parallel die Entwicklung von Leichtwasserreaktoren voranzutreiben.
In Russland lag in der Anfangszeit der kerntechnischen Entwicklung der Schwerpunkt bei Reaktoren mit schnellem Neutronenspektrum (SFR, später auch LFR) in Verbindung mit Wiederaufarbeitung (Mayak, Pilotanalage sowie Brennelemente-Fabrik für Uran-Plutonium-Mischoxidbrennstoffe in Zheleznogorsk). In der Folge wurde dieser Schwerpunkt vertieft (BN-600, BN-800). Aktuell befindet sich das russische Innovationssystem bzgl. alternativer Reaktorkonzepte in einer Phase, in der die Forschungsinfrastruktur älter wird (BOR-60, seit 1969 in Betrieb) und Projekte aufgeschoben werden (z. B. BN-1200), derzeit wird der BREST-OD-300 priorisiert. Russland hält an der Langzeitstrategie fest, einen sogenannten geschlossen Brennstoffkreislauf mit Hilfe von Reaktoren mit schnellem Neutronenspektrum zu erreichen und parallel die Entwicklung von Leichtwasserreaktoren voranzutreiben.
China
China hat seit den 1960er Jahren sein nukleares Innovationssystem durch eine Importstrategie vorangetrieben. Nach militärischen Entwicklungen in den 1950er Jahren wurden sowohl bei Leichtwasserreaktoren als auch bei alternativen Reaktorkonzepten Fortschritte erzielt. Letztere werden parallel zum Ausbau der Leichtwasserreaktoren entwickelt. Dabei hat China ein breites Spektrum von Technologielinien aufgebaut, insbesondere Schnelle Reaktoren und Hochtemperaturreaktoren. Derzeit befinden sich die Projekte noch im Bereich der Forschung und Entwicklung bzw. im Bau und Betrieb von Prototypen. Ende 2023 ist Hochtemperatur-Reaktor (Shidao Bay-1) in den kommerziellen Betrieb übergegangen. Eine breite, kommerzielle Nutzung ist noch nicht abzusehen.
Südkorea
Südkorea ist eines der führenden Industrieländer und hat sich, ursprünglich mit Unterstützung der USA, zu einem der wenigen Anbieter für Reaktortechnik entwickelt. Südkorea verfügt über ein umfangreiches eigenes kommerzielles Atomkraftprogramm, welches in den 2000er Jahren auch Exporte verzeichnen konnte. Das Land unterhält bezüglich Forschung und Entwicklung besonders intensive Beziehungen mit den USA. Im Bereich alternativer Reaktorkonzepte intensiviert Südkorea die Beteiligung an ausländischen, insbesondere amerikanischen Entwicklungen. Darüber hinaus werden eigene Entwicklungen weitergeführt, z. B. von Wiederaufarbeitungstechnologien in Verbindung mit Schnellen Reaktoren. Eine kommerzielle Nutzung dieser Reaktorkonzepte ist derzeit nicht absehbar.
Belgien
Nachdem Belgien historisch bedingt in den 1950er Jahren zu den ersten Ländern mit kommerzieller Atomkraftwerksnutzung wurde, hat es seit dieser Anfangsphase ein kleines nationales Innovationssystem entwickelt. Belgiens Aktivitäten für die Entwicklung von alternativen Reaktorkonzepten fokussieren sich auf die Entwicklung und Internationalisierung des Forschungsprojektes MYRRHA, einer Kombination von einem beschleunigergetriebenen unterkritischen Reaktor (ADS) und einem Blei-Bismutgekühlten Schnellen Reaktor (eine Variante des LFR). Initiale Zeitpläne und Kostenschätzungen wurden überschritten und es bestehen Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Projektes.
Polen
In Polen wird seit mehreren Jahrzehnten der Einstieg in die kommerzielle Kernenergie diskutiert. Dieser ist jedoch bis heute noch nicht umgesetzt. Seit den 1950er Jahren wird in geringem Maßstab an Reaktortechnik geforscht, vor allem am Forschungsreaktor MARIA (seit 1974 in Betrieb). Bezogen auf alternative Reaktorkonzepte ist zu beobachten, dass Polen Wissen aufbaut, indem sich polnische Wissenschaftler:innen an europäischen Forschungsprojekten beteiligen. Insbesondere wird ein Fokus auf die Entwicklung von Hochtemperaturreaktoren gesetzt, u. a. mit Erwägungen zum Bau eines gasgekühlten Hochtemperatur-Forschungsreaktors (TeResa).
Untersuchung ausgewählter Regelwerke
Damit ein Kernkraftwerk gebaut und betrieben werden darf, muss im Vorfeld ein Sicherheitsnachweis erbracht werden. Darin muss der Betreiber darlegen, welche Risiken von der Anlage ausgehen und welche Maßnahmen er zu Reduzierung dieser Risiken ergreift.
Das nationale Regelwerk eines Landes legt dabei fest, welche Anforderungen ein Reaktor erbringen muss, um eine Genehmigung zu erhalten. Die Regelwerke legen zum einen grundlegende Anforderungen fest (zielorientierte Regelwerke), zum anderen geben sie auch konkrete technische Ausführungen vor bzw. stellen Anforderungen mit Bezug auf konkrete technologische Lösungen (präskriptive Regelwerke).
Die Regelwerke wurden überwiegend auf Basis der Erkenntnisse aus Bau und Betrieb der heutigen, wassergekühlten Reaktorkonzepte entwickelt. Die untersuchten alternativen Reaktorkonzepte unterscheiden sich jedoch in mehreren Aspekten deutlich von wassergekühlten Reaktorkonzepten. Die präskriptiven Regeln sind daher oft nicht direkt auf alternative Reaktorkonzepte übertragbar.
Nationaler und internationaler Stand der RegelwerkeEinklappen
Im Forschungsvorhaben untersuchten die Autoren der Studie, inwieweit sich die Regelwerke der USA, von Kanada und dem Vereinigten Königreich auf alternative Reaktorkonzepte anwenden lassen. Auch Regelwerke folgender internationaler Organisationen werden in der Studie betrachtet:
- die Internationale Atomenergie Organisation (IAEO),
- die Nuklearenergieagentur der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD/NEA) und
- der Verband Westeuropäischer Nuklearregulierungsbehörden (WENRA)
Zusammenfassend lässt sich darstellen, dass es in den untersuchten Ländern noch kein Regelwerk gibt, das geeignet ist, um einen Sicherheitsnachweis für alternative Reaktorkonzepte zu erbringen. Die untersuchten Länder und Organisationen überarbeiten daher ihre Regelwerke. Bei den neuen Regelwerken soll verstärkt auf zielorientierte, technologieoffene Vorgaben gesetzt werden.
Dieses Vorgehen könnte aber dazu führen, dass der Aufwand für Antragsteller und Genehmigungsbehörde zur Erstellung und Prüfung des Sicherheitsnachweises steigt. Ein Grund hierfür ist das Fehlen von Erfahrungen aus dem Betrieb der Anlagen. Dies kann zur Folge haben, dass entsprechende Genehmigungsverfahren einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen werden.
Regelwerke ausgewählter LänderEinklappen
Die Auswertung der Regelwerke der USA, von Kanada und dem Vereinigtem Königreich ergab folgende Ergebnisse:
USA:
In den USA gibt es aktuell zwei Verfahren zur Genehmigung von Kernkraftwerken. Beide enthalten präskriptive Anforderungen, die sich nicht einfach auf alternative Reaktorkonzepte übertragen lassen. Daher entwickelt die US-amerikanische Genehmigungsbehörde (Nuclear Regulatory Commission – NRC) ein neues Regelwerk, das stärker zielorientiert und technologieoffen sein soll. Das Regelwerk soll 2027 fertiggestellt sein.
Kanada:
Das kanadische kerntechnische Regelwerk ist eher zielorientiert als präskriptiv aufgebaut, was die Nutzung für alternative Reaktorkonzepte erleichtern sollte. Dennoch sieht die zuständige Genehmigungsbehörde (Canadian Nuclear Safety Commission – CNSC) die Notwendigkeit einer Überarbeitung. Ziel ist die Entwicklung eines technologieneutralen Regelwerks, ein Zieldatum steht noch nicht fest.
Vereinigtes Königreich:
Die Aufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich (Office for Nuclear Regulation – ONR) verfolgt ein Arbeits- und Forschungsprogramm, um ihre Kompetenzen im Bereich alternativer Reaktorkonzepte zu verstärken und Anforderungen für die Genehmigung von neuen Reaktoren zu überarbeiten. In einem ersten Schritt wurde das Verfahren zur Durchführung eines Generic Design Assessments erneuert. Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche Vorprüfung des Konzepts durch das ONR mit dem Ziel, dem Entwickler frühzeitig mögliche Probleme aufzuzeigen.
Eine Überprüfung grundlegender Richtlinien durch das ONR hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf alternative Reaktorkonzepte ist vorgesehen. Erste Forschungsberichte hierzu liegen vor, das ONR sieht allerdings noch erheblichen zukünftigen Forschungsbedarf.