Demokratisierung der Energiewende in Hamburg: Was sollen Beiräte bei den Netz-Unternehmen leisten?
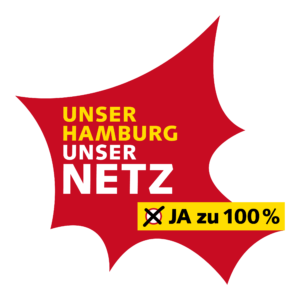
Die Rekommunalisierung der Energienetze nach dem erfolgreichen Volksentscheid vom September letzten Jahres in Hamburg könnte auch neue Perspektiven für mehr Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung in der Energiewende zur Folge haben. Bereits seit Monaten wird auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen ein Wärme-Dialog geführt, der sich nicht nur mit den Alternativen für das alte kohlebefeuerte Heizkraftwerk in Wedel befasst und der inzwischen auch von der SPD-Fraktion und sogar der Umweltbehörde aufgegriffen wird – nachdem Grüne und Linke schon länger die Forderungen der Rekommunalisierungs-Initiativen unterstützen. Jetzt könnte die Mitbestimmung auch auf Unternehmensebene Einzug halten: Ein Vorschlag, bei den Netz-Unternehmen neben schlichten Kundenbeiräten zusätzlich Beiräte für eine „politisch-gesellschaftliche Rückkoppelung“ (SPD-Antrag) einzurichten, könnte der Einstieg in die Debatte um ein gutes Modell sein.
Die SPD hat auf Initiative von Fraktionschef Andreas Dressel Beiräte vorgeschlagen, die schrittweise bei den drei Gesellschaften etabliert werden sollen, die nach dem Volksentscheid mit unterschiedlichen Fristen rekommunalisiert werden sollen. Dressel bezieht sich mit diesem Vorschlag ausdrücklich auf den zweiten Satz des Volksentscheids, in dem mehr demokratische Kontrolle in der Energiewende gefordert wurde.
Beiräte bei allen drei Netzgesellschaften sofort!
Dabei sei schon eines angemerkt: Dressel spricht davon, dass ein solcher Beirat zunächst beim Stromnetz und erst später bei der Fernwärme und beim Gasnetz eingeführt werden. Hintergrund ist offenbar, dass nur beim Stromnetz die Stadt inzwischen zu 100 Prozent Eigentümer ist. Bei den anderen ist die Stadt bislang nur mit 25,1 Prozent beteiligt. Insofern mag der Vorschlag von Dressel beim Vorgehen zunächst plausibel sein. Aber: Der Senat hat vielfach seine Minderheitsbeteiligung mit einem erheblichen Einfluss auf die Unternehmenssteuerung selbst gelobt. Jetzt kann er zeigen, dass vielleicht doch etwas an dieser Behauptung dran ist: Insbesondere bei der Vattenfall-Fernwärme ist zu fordern, dass auch hier ein Beirat sofort eingesetzt werden sollte. Vor allem auch deshalb, weil hier mit der lediglich vereinbarten Kauf-Option deutliche Unklarheiten hinsichtlich der Übernahme bestehen.
Debatte: Was soll Aufgabe der Beiräte sein?
Genaue Festlegungen sind in der entsprechenden Drucksache der SPD-Fraktion, die in den zuständigen Ausschuss überwiesen wurde, noch nicht erfolgt. Allerdings soll sich Dressel im Umweltausschuss Anfang Juni dahin gehend geäußert haben, dass der Beirat keine Aufgaben oder Kompetenzen bekommen solle, die mit denen des Aufsichtsrats vergleichbar wären. Doch ob es bei dieser Vorstellung bleibt, wird die Debatte in den nächsten Monaten zeigen. Die Umweltverbände und andere NGOs werden sicherlich ebenso wie die Gewerkschaften bzw. ArbeitnehmerInnen in den nächsten Wochen und Monaten ihrer Anforderungen diskutieren und einbringen. Und die Linken und Grünen in der Bürgerschaft haben da sicher auch noch Ideen.
Dressel hat inzwischen mitgeteilt, dass in der Umweltbehörde ein Vorschlag für eine Geschäftsordnung eines solchen Beirats zunächst bei der Stromnetzgesellschaft erarbeitet werde und dann im Umweltausschuss weiter beraten werden soll. Das wird vermutlich nicht mehr vor der Sommerpause sein. Aber im Ausschuss werden dann auch die Volksentscheids-Initiative, die Arbeitnehmervertreter und die Wirtschaft als „Auskunftspersonen“ mit am Tisch sitzen. Damit ist – und das ist gut so – eine breitere Grundlage für die anstehende Debatte gelegt.
Gut und sinnvoll wäre es sicher, darüber hinaus Formen einer verbindlichen Debatte um die Ausgestaltung zu finden. Ansatz dafür könnte vielleicht ein Antrag der Linken in der Bürgerschaft sein, der im Bereich Wärme-Dialog solche neue Formen zum Thema hat. Eine Anhörung in der Bürgerschaft wäre sicherlich nützlich, um dieses Handlungsfeld voran zu bringen.
- Umsetzung Volksentscheid Energienetze Hamburg: Bürgerschaft debattiert Wärme-Dialog
- Siehe auch zum Beitrag der EnergieNetz-Genossenschaft: Mehr demokratische Kontrolle in den Hamburger Energienetzen und die EnergieNetz-Genossenschaft
In die Beiräte will Dressel zunächst die derzeit im Rahmen der Umsetzung in der Bürgerschaft beteiligten „Auskunftspersonen“ aufnehmen. Ausdrücklich nennt die SPD-Fraktion in dem Antrag die derzeitige Parlaments-Praxis als Vorbild für den Beirat. Das ist sicherlich ein pragmatisch sinnvoller Ansatz und Ausgangspunkt. Aber natürlich dürfte auch der SPD-Fraktion und Andreas Dressel klar sein, dass es hier noch vieles zu klären gibt und auch andere Interessen bzw. gesellschaftliche Bereiche zu berücksichtigen sein dürften.
Beirat? Beteiligung und Mitbestimmung?
In Reihen der Unterstützergruppen für die Rekommunalisierung der Hamburger Energienetze ist vielfach betont worden, dass es bei einer reinen Verstaatlichung nicht bleiben dürfe. Zu stark waren für Viele die Erinnerungen an alte HEW-Zeiten. Damals wurden die HEW oftmals im direkten Zugriff der jeweils regierenden Mehrheits-Partei – im Hamburg meist die SPD – benutzt. So wurde der staatliche Konzern in die Atomenergienutzung „bestimmt“ oder Ende der 90er Jahre einfach verkauft, weil neoliberale Konzepte und Privatisierungen bis tief hinein in die SPD en vogue waren. Interessen von VerbraucherInnen, Umweltverbänden, MieterInnen und vielen mehr, hatten keine Stimme und bestenfalls außerparlamentarische Möglichkeiten, die Energiepolitik zu beeinflussen. Entschieden hat meist die SPD-Führung und ein viel zu starker Vorstand.
Die jetzt laufende Rekommunalisierung muss daher mehr für Transparenz, Beteiligung und Mitbestimmung bringen. Nur so ist der Volksentscheid sinngemäß zu verstehen. Auch wenn dort nur „demokratsiche Kontrolle“ gefordert wird und Finanzsenator Peter Tschentscher die Auffassung vertritt, dass mit der Kontrolle durch die Bürgerschaft diese Kontrolle erfüllt sei.
Wer zwischen Stuttgart 21, dem Berliner Flughafen und der eigenen Elbphilharmonie nur ein klein wenig versteht, was eigentlich gesellschaftlich los ist, der wird einsehen, dass es mehr braucht, als den Status Quo der 90er Jahre wieder herzustellen. Andreas Dressel, so könnte man jedenfalls vermuten, hat das verstanden, andere in der SPD sicherlich noch nicht.
Die wichtigere Frage aber ist: Was wollen die Initiativen, Verbände, Organisationen von Umwelt, MieterInnen, VerbraucherInnen bis hin zu den Gewerkschaften, Kirche etc. von einem solchen Beirat? Wie sieht ein Mehr an demokratischer Mitsprache bei solchen Beiräten aus? Reicht Beteiligung oder braucht es echte Eingriffsrechte?
Vorbild Berlin? Direkt-demokratische Elemente und Verwaltungsrat
Der Berliner Energietisch hatte bei seinem nur knapp gescheiterten Volksentscheid zur Rekommunalisierung des dortigen Stromnetzes einen Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt.
Der Stromgesellschaft sollte als Organ ein Verwaltungsrat (§4) zur Seite gestellt werden, der alle relevanten Rechte und Aufgaben gegenüber der Geschäftsführung übernehmen sollte und in dem neben Senatsvertretern, ArbeitnehmerInnen auch sechs direkt vom Volk gewählte Personen vertreten sein sollten. Dabei entspricht der Verwaltungsrat im Berliner Model im Groben den Funktionen eines Aufsichtsrats bzw. ist vielleicht sogar noch stärker in seinen Möglichkeiten gedacht gewesen.
Das Berliner Modell könnte zumindest als ein Modell mit sicherlich „erweiterten Vorstellungen“ von „Mehr Demokratie“ bei der Umsetzung des Volksentscheids in Hamburg sein. Und man kann, muss aber nicht, das direkt-demokratische Instrument der Wahl eines Teils der Mitglieder eines solchen Gremiums mit der Frage, welche Kompetenzen es hat, verknüpfen. Beantwortet werden aber muss – so oder so – die Frage, wer setzt ein wie auch immer geartetes Gremium eigentlich ein und wie ist es aus welchen Gründen zusammengesetzt?
Beiräte der Netz-Unternehmen in Hamburg: Reale Mitbestimmung, nicht nur Beteiligung und Information
Entscheidend für die Ausgestaltung eines Beirats in Hamburg dürfte zunächst sein, welche Kompetenz dieses Gremium bekommen soll und wo genau es angesiedelt wird. Klar sollte sein, dass es im Sinne des vom Volksentscheid im Satz 2 erklärten Ziels einer „demokratischen Kontrolle“ nicht lediglich um Mitwirkung, sondern auch um Mitbestimmung gehen muss. Unerlässlich wird es sein, dass ein solcher Beirat in der Satzung des jeweiligen Unternehmens aufgenommen und seine Aufgaben, Rechte und Pflichten klar geregelt werden.
Als Zielsetzung hat der Volksentscheid neben der demokratischen Kontrolle außerdem die Energiewende im Sinne eines Ausbaus der (dezentralen) Erneuerbaren Energien sowie deren sozial gerechte Ausgestaltung genannt. Diese Zielsetzungen zu konkretisieren und handhabbar zu machen, ist jetzt in der Debatte und es gilt zu gemeinsamen Verabredungen zu kommen. Diese Debatte muss u.a. in einem Leitbild münden, dem das Unternehmen per Satzung künftig verpflichtet sein muss. Ein solches Leitbild schafft dann für alle Beteiligten – auch den Beirat – einen klaren Rahmen, vor dem die Entwicklung bzw. Steuerung des Unternehmens jeweils bewertet werden kann.
Die Frage dürfte sein, in welchem Umfang und mit welchen Verfahren ein solcher Beirat installiert werden soll. Dabei geht es nicht nur um Rechte und Pflichten gegenüber der Geschäftsführung und dem jetzigen Aufsichtsrat. Es wird außerdem um die Debatte gehen müssen, wer in diesem Gremium vertreten sein und wie diese Zusammensetzung letztlich legitimiert werden soll.
Ein wichtiger Aspekt muss in jedem Fall hinzukommen, weil sich das in den letzten Jahren bei vielen durchgeführten Beteiligungs- und Dialogverfahren als Problem gezeigt hat: Vor allem die ehrenamtlichen, gesellschaftlichen Akteure müssen mit zusätzlichen (auch finanziellen) Ressourcen ausgestattet werden, damit zwischen den überaus unterschiedlichen Akteuren etwas erreicht werden kann, was oft mit dem Wort „auf Augenhöhe“ umschrieben wird.
Ein wirkungsvoller Beirat muss auch das Recht haben, die mittel- und langfristige Finanzplanung und Investitionen wirkungsvoll zu beeinflussen. Es muss für den Fall von Konflikten ein sinnvolles Verfahren entwickelt werden, in dem diese möglichst konsens-orientiert gelöst werden können. Auch in Fragen der Bestellung der Geschäftsführung muss es Zustimmungs-Regelungen für den Beirat geben.
Wohlgemerkt: Diese Mitbestimmungsrechte greifen nicht in die direkte Geschäftstätigkeit ein, sondern sollen die grundsätzliche mittel- und langfristige Entwicklung des betroffenen Unternehmens steuern.
Diese bisherigen Anmerkungen bzw. formulierten Anforderungen sind sicherlich sehr schlaglichtartig und brauchen noch einiges an Konkretisierung. Vor allem sollen sie erst einmal nicht viel mehr als Anregungen sein. Aber möglicherweise könnten sie die Ansatzpunkte beschreiben, um die es für ein wirkliches Mehr an demokratischen Mitbestimmungsrechten in der Umsetzung des Volksentscheids und bei der Energiewende gehen sollte. Klar ist aber auch: Es ist immer auch eine Frage vom Macht, ob die SPD und andere eine solche Mitbestimmungsperspektive ernsthaft ermöglichen wollen.
Die weitere Debatte über diese Fragestellungen jedenfalls dürfte eine überaus spannende sein, weil sie möglicherweise eben auch echtes Demokratie-Neuland für mehr Mitbestimmung betreten muss. Das dürfte nicht von jetzt auf gleich, aber vielleicht von heute auf morgen gelingen, wenn nicht machtpolitische Eingriffe – z.B. nach der nächsten Bürgerschaftswahl – diese Ansätze wieder zuschüttet. Dass das nicht passiert, steht auch in der Verantwortung der Bürgerbewegungen für die Energiewende, jetzt konkret diese Debatte einzufordern und eigene Vorstellungen auf den Tisch zu legen.





