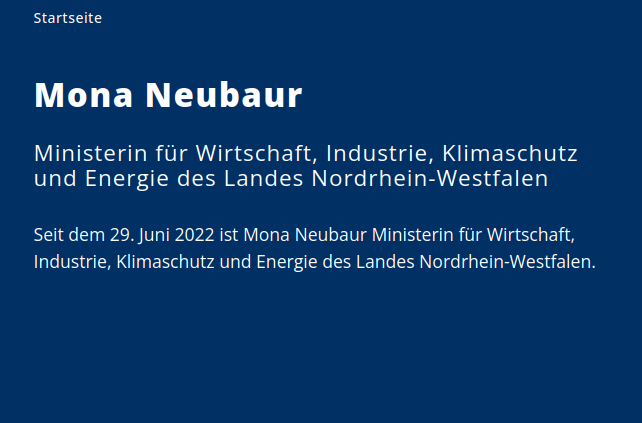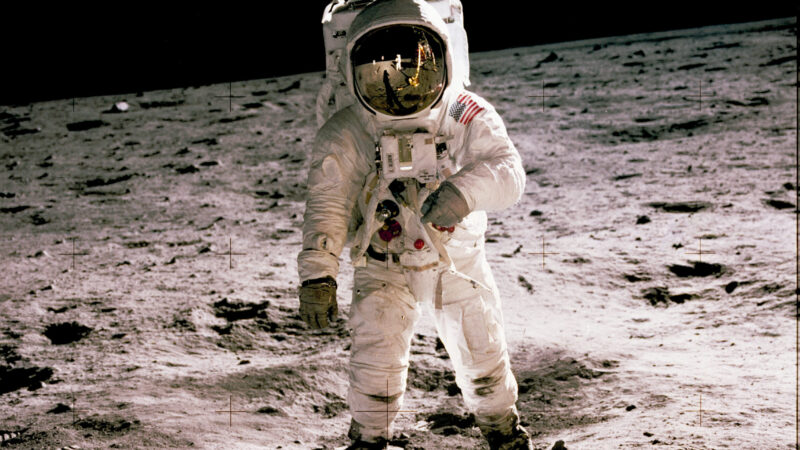Atommülllagerung, Politik, Unsicherheit: Das Problem ist viel größer …
 Atommüll-Endlager-Suche der Bundesregierung. Nach dem Beschluss über das Endlagersuchgesetz im Sommer 2013 soll nun am 10. April die darin vorgesehene Kommission eingesetzt werden, die sich mit den Anforderungen und den Kriterien für das Suchverfahren und die dauerhafte Atommülllagerung (Endlagerung) hochradioaktiver Abfälle befassen soll. Zu den vielen Problemen und Mängeln, die die Umweltverbände bislang davon abhalten, sich an dieser Kommission zu beteiligen, gehört auch, dass enorme Mengen leicht- und mittelaktiven Atommülls überhaupt nicht betrachtet werden sollen, obwohl ihre dauerhafte Lagerung völlig ungeklärt ist. Ebenfalls außen vor bleiben auch die wachsenden Sicherheitsmängel, die sich bereits bei der Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle zeigen.
Atommüll-Endlager-Suche der Bundesregierung. Nach dem Beschluss über das Endlagersuchgesetz im Sommer 2013 soll nun am 10. April die darin vorgesehene Kommission eingesetzt werden, die sich mit den Anforderungen und den Kriterien für das Suchverfahren und die dauerhafte Atommülllagerung (Endlagerung) hochradioaktiver Abfälle befassen soll. Zu den vielen Problemen und Mängeln, die die Umweltverbände bislang davon abhalten, sich an dieser Kommission zu beteiligen, gehört auch, dass enorme Mengen leicht- und mittelaktiven Atommülls überhaupt nicht betrachtet werden sollen, obwohl ihre dauerhafte Lagerung völlig ungeklärt ist. Ebenfalls außen vor bleiben auch die wachsenden Sicherheitsmängel, die sich bereits bei der Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle zeigen.
Darüber informierten Umweltverbände auf der vom Deutschen Naturschutzring (DNR) organisierten Tagung „Atommüll ohne Ende – Auf der Suche nach einem besseren Umgang“. Die Politik wirbt massiv darum, dass die Umweltverbände und Anti-Atom-Initiativen doch bitte bei der Endlagersuche mitmachen sollen. Mit vielen moralischen Appellen und nur wenigen Zugeständnissen an die Forderungen der Umweltverbände sollen sie doch bitte darauf vertrauen, dass der behauptete „Neustart“ wirklich ernst gemeint sei. Dass für Vertrauen kein Anlass besteht und dass moralische Appelle angesichts des Ausmaßes der ungelösten Probleme mit der gesamten Atommülllagerung nicht ausreichen, zeigt der folgende Überblick über die derzeitige Atommüll-Situation. Die folgenden Beispiele zeigen auch: Immer noch sorgen politische Eingriffe zugunsten der Atomwirtschaft dafür, dass Sicherheitsfragen außer acht bleiben.
- Siehe dazu auch hier: ATOMMÜLL: Wir müssen uns Sorgen machen – Eine Bestandsaufnahme für die Bundesrepublik Deutschland
- Tiefflug beim Neustart: Parteienstreit bei Endlagersuche zeigt wie wenig das Verfahren taugt
- Debatte und Tagung: Atommüll ohne Ende – Auf der Suche nach einem besseren Umgang
Atommüll-Problem 1: Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle
- Die Standort-Zwischenlager für hochradioaktive Brennelemente
Das Urteil des Oberverwaltungsgericht Schleswig vom Sommer 2013 hob die Genehmigung für das Castor-Lager am Vattenfall-AKW Brunsbüttel auf. Zahlreiche Sicherheitsnachweise seien demnach nicht ausreichend oder sogar falsch erbracht worden, stellte das Gericht fest. Es ging um die Frage, welche Auswirkungen der gezielte Beschuss mit panzerbrechenden Waffen oder ein (gezielter) Flugzeugabsturz auf ein solches Castor-Lager für die Menschen in der Umgebung haben könnte.
Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und rein rechtlich nur für das Lager in Brunsbüttel gilt: Alle sogenannten Standort-Zwischenlager sind im Zeitraum zwischen 2002 – 2005 quasi in Serienfertigung genehmigt und gebaut worden, also kurz nach den Terroranschlägen am 11.9.2001 auf das World-Trade-Center in New York und das Pentagon in Washington. Insofern ist klar: Die in Brunsbüttel festgestellten Mängel dürften auch für alle anderen Castor-Lager an allen Standorten gelten.
Derzeit versuchen die Genehmigungsbehörde (Bundesamt für Strahlenschutz) und der Betreiber Vattenfall das OVG-Urteil noch zu Fall zu bringen. Aber: Anti-Atom-Initiativen und Verbände hatten frühzeitig auf diese Mängel und Risiken immer wieder hingewiesen (und Klagen auf den Weg gebracht). Hinweise, die aus heutiger Sicht offenbar auch das Bundesamt für Strahlenschutz für berechtigt hielt, die es aber im Genehmigunsverfahren nicht im vollen Umfang berücksichtigen durfte.
- BMU und Betreiber hindern Bundesamt für Strahlenschutz, höhere Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen
Offenbar hinderten Betreiber und Bundesumweltministerium das Bundesamt für Strahlenschutz daran, diese Risiken umfangreich bei der Genehmigung zu berücksichtigen und ggfls. entsprechende Auflagen zu erteilen.
Darauf verweist das BfS indirekt in seiner Stellungnahme zum Urteil des OVG Schleswig. Dort heißt es: „Das BfS hat bei der Genehmigung des Zwischenlagers Brunsbüttel das zum Genehmigungszeitpunkt geltende Regelwerk angewandt. Es ist bei der Prüfung des gezielten Flugzeugabsturzes nach dem 11. September 2001 gegen den Widerstand der Stromversorger sogar darüber hinaus gegangen (Hervorhebung umweltFAIRaendern). Bei allen Zwischenlagern wurde der gezielte Flugzeugabsturz bereits in den Genehmigungsverfahren berücksichtigt und mit überprüft.“
Aber offenbar nicht in dem Umfang, wie es das BfS eigentlich für erforderlich gehalten hätte, denn das BfS berichtet weiter: „Die Bewertungsmaßstäbe und die zu betrachtenden Szenarien sind im untergesetzlichen Regelwerk festgelegt, das vom Bundesumweltministerium als zuständiger Regulierungsbehörde herausgegeben wird und in das unter anderem die Analysen der Sicherheitsbehörden einfließen. Das BfS wendet dieses Regelwerk an, legt es jedoch nicht selbst fest (Hervorhebung umweltFAIRaendern).“
Das liest sich wohl völlig zurecht als eine (dezente) Distanzierungserklärung gegenüber dem BMU und als Hinweis darauf, dass das BfS auch gegenüber dem vorgesetzten Umweltministerium höhere Anforderungen gestellt hat, diese aber beim BMU nicht gewollt waren und daher im Genehmigungsverfahren nicht berücksichtigt werden durften.
Es waren also Eingriffe der Politik zugunsten der AKW-Betreiber, die dafür sorgten, dass bei der Genehmigung der Castor-Zwischenlager an den Standorten Sicherheitsanforderungen nicht in ausreichendem Maße vom Bundesamt für Strahlenschutz einbezogen werden durften. Das Urteil des OVG Schleswig ist daher im Grunde eine Bestätigung für die vom BfS geforderten höheren Sicherheitsbetrachtungen, die es auf Anweisung des BMU aber nicht umsetzen durfte.
- Wie weitreichend diese Problematik ist? Hier weiter lesen: Atomkraftwerke: Kommt die Stilllegung per Gericht?
- Atomanlagen und das Risiko von Terrorangriffen – Illegaler Betrieb von Atomkraftwerken
- 152 Castoren mit hochradioaktivem Atommüll werden ohne ausreichende Sicherheit gelagert:
Insgesamt 152 Castorbehälter mit hochradioaktiven Brennelementen werden dort nur noch per Ausnahmeverordnung gelagert. Das bisherige Zwischenlager ist nach dem Atomrecht nicht mehr als sicher anzusehen und müsste eigentlich aufgelöst werden. Da aber die gesamte Entsorgung für den hochradioaktiven Atommüll ungelöst ist, bleibt der brisante Abfall einfach wo er ist. Atompolitik Deutschland 2013!
Atommüll-Problem 2: Lagerung von leicht- und mittelradioaktiven Materialien beim Rückbau der Atomanlagen
„Für den in Deutschland produzierten und weiter anfallenden Atommüll braucht es mehr als ein Endlager. Die 2013 neu angeschobene Suche nach einer Lagerstätte für die abgebrannten Brennstäbe aus Kernkraftwerken und die hochradioaktiven Rückstände aus der Wiederaufbereitung greift deshalb zu kurz. Das ist die vorherrschende Meinung bei vielen Umweltverbänden und Bürgerinitiativen“, berichtet der Tagesspiegel.
Dass es nicht nur bei der dauerhaften Lagerung von hochradioaktivem Atommüll massive Probleme gibt, stellt laut einem Bericht der Zeit auch die baden-württembergische Landesregierung inzwischen fest. Die soll von Fachleuten ein 18-seitiges Papier erarbeitet lassen haben: „Die baden-württembergische Landesregierung schlägt nun Alarm – nicht nur wegen des heißen Mülls, sondern auch wegen der noch viel größeren Menge schwach- und mittelaktiven Atommülls, für den es ebenfalls keine gesicherte Entsorgung gibt. Aus einem internen Papier des von dem Grünen Franz Untersteller geführten Stuttgarter Umweltministeriums geht hervor, wie verfahren die Lage wirklich ist. Die nach der Atomkatastrophe von Fukushima beschlossene Stilllegung von acht Atommeilern hat das Problem noch verschärft: Zwecks Risikominimierung gehörten sie schnell abgebaut – doch wohin mit den Bergen radioaktiven Materials, das weiß niemand.“ Der leicht- und mittelaktive Atommüll ist eigentlich vorgesehen für das im Bau befindliche Atommülllager im Schacht Konrad in Salzgitter. Doch mit dem gibt es immer mehr Probleme und die Inbetriebnahme verzögert sich immer weiter (siehe unten).
Das hat Folgen: Beim Rückbau der Atomanlagen können die anfallenden leicht- und mittelradioaktiven Abfälle also nicht abtransportiert werden, weil ein dauerhaftes Atommülllager für diese nicht zur Verfügung steht. Also werden künftig an allen AKW-Standorten weitere Atommüll-Hallen gebaut werden müssen. Das kostet nicht nur Geld (von wegen billige Atomenergie). Da unklar ist, wie lange der leicht- und mittelaktive Atommüll an den Standorten bleiben wird, stellen sich auch an die Sicherheit viele Fragen – für die es bislang keine Antworten gibt.
Atommüll-Problem 3: Enorme Mengen Uranmüll werden immer noch ignoriert
Große Atommüllmengen werden bis heute von der Politik geflissentlich „übersehen“. Über sie wird nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen: Bereits 2011 berichteten u.a. die Mitteldeutsche Zeitung und der Spiegel (2013) darüber : “Zu dem hochradioaktiven Müll sollen auch bis zu 100 000 Kubikmeter abgereichertes Uran hinzukommen, das nicht in das Endlager Konrad für schwach- und mittelradioaktive Abfälle gebracht werden kann. … Die Mengen würden bei weiten das Volumen hochradioaktiver Abfälle übertreffen, die auf 29 000 Kubikmeter geschätzt werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rechnet zudem mit bis zu 5000 Kubikmetern Abfällen mit geringer Wärmeentwicklung, die nicht für Schacht Konrad geeignet sind. Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) geht hier von bis zu 8800 Kubikmetern aus. Hinzu kommen graphithaltige Abfälle von 500 bis 1000 Kubikmetern.”
Vor allem der Umgang mit den uranhaltigen Abfällen aus Gronau demonstriert, wie wenig „Neustart“ im staatlichen Umgang mit den strahlenden Hinterlassenschaften der Atomwirtschaft stattfindet. Das in großen Mengen anfallende abgereicherte Uran wird offiziell nicht als Atommüll, sondern als Wertstoff definiert. Damit braucht es bei der Atommüll-Entsorgung nicht beachtet zu werden. Der Bundesregierung ist zwar nicht bekannt, wie eine künftige Verwertung dieser Uranabfälle aussieht, dennoch lässt sie es zu, dass der Betreiber URENCO mit diesen Uran-Stoffen so verfährt.
“Konkrete Verwendungsvorhaben sind der Bundesregierung nicht bekannt”, teilt sie mit, ohne offenbar Anstoß daran zu nehmen (siehe Antwort auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Dorothée Menzner hier (PDF)).
Eine neue Lagerhalle für diese ca. 60.000 Tonnen Uranmüll wird demnächst in Gronau in Betrieb gehen. Und weitere könnten hinzu kommen, wenn die Anlage nicht stillgelegt wird. Etwa alle zehn Jahre – so die Bundesregierung – braucht es beim normalen Betrieb eine weitere Lagerhalle in dieser Größenordnung. Und der Clou obendrauf: Die Lagerung als „Wertstoff“ ist völlig unbefristet. In Großbritannien hat der Betreiber URENCO schon mal die Lagerung bis 2120 ins Auge gefasst.
- Urangeschäfte der URENCO: Neue Atomanlage und 100 Jahre Zwischenlagerung
- Uranfabrik URENCO Gronau: Immer mehr Atommüll, Lagerhallen und Atomtransporte
- Immer neue Atommülllager: An der Uranfabrik Gronau völlig unbefristet
Atommüll-Problem 4: Der Strahlenmüll aus dem absaufenden Atomlager ASSE II
Aber nicht nur der anfallende Atommüll beim Rückbau der abgeschalteten Atomkraftwerke stellt ein Problem dar. Im Tagesspielgel stellt Udo Dettmann fest: „Völlig ungeklärt sei, wo die rund 126 000 Fässer gelagert werden sollen, die sich derzeit noch im maroden Lager Asse befinden.“
In der ASSE II bei Wolfenbüttel wurde bis 1978 leicht- und mittelradioaktiver Atommüll unter dem Vorwand der Endlager-Forschung in großem Stil versenkt. Dabei schreckten Behörden und Wissenschaft vor nichts zurück: So wurden Forschungs-Projekte wie der „Versuch der nicht–rückholbaren Endlagerung“ (PDF) erprobt – absurder gehts nicht.
Der Grund für derartigen Irrsinn, mit dessen katastrophalen Folgen wir zu tun haben: Weil sich der Atommüll schon in den 1970er Jahren an den Anlagen auftürmte, die ungelöste Atommüllentsorgung wegen des weiter geplanten Ausbaus der Atomenergie aber öffentlich nicht sichtbar werden sollte und die Betreiber für teure Lagerhallen Geld sparen wollten, musste das „Zeugs einfach irgendwo hin“. Da bot sich die ASSE als kostengünstiger Ausweg für die Atomwirtschaft an. Die Politik machte den Weg frei.
Dass bereits damals die Menschen vor Ort, die sich mit Salzbergwerken überaus gut auskannten, davor warnten, weil es aus ihrer Sicht nur eine Frage der Zeit war, wann die ASSE II absaufen und einstürzen würde, wurde mit schein-wissenschaftlichen Expertisen und viel Ignoranz der Politik und Behörden einfach vom Tisch gewischt. (Bis heute mischen einige der damaligen Experten bei der Suche nach einer dauerhaft sicheren Lagerstätte für Atommüll mit.)
Wovor die Bevölkerung immer gewarnt hat, ist inzwischen eingetreten und bekannt: Der ASSE-Salzstock droht einzustürzen und abzusaufen. Weil damit eine erhebliche radioaktive Verseuchung der unterirdischen Wasserläufe droht (die irgendwann an die Oberfläche kommt), wird derzeit versucht, den Atommüll zu bergen.
Gelingt dieses überaus komplizierte Unternehmen, steht das nächste Problem vor der Tür: Niemand weiß derzeit, wo das strahlende Material dann hin soll. In den Schacht Konrad kann es nach den derzeitigen Einlagerungsbestimmungen in jedem Fall nicht.
Atommüll-Problem 5: Schacht Konrad – Politische Entscheidungen statt Sicherheit
Als dauerhaftes Lager für leicht- und mittelradioaktive Atomabfälle ist der Schacht Konrad in Salzgitter vorgesehen. Doch weil sich aufgrund immer neuer sicherheitsrelevanter Probleme der Ausbau immer weiter verzögert, steht das Lager auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung. Inzwischen geht kaum noch jemand davon aus, dass vor 2024 eine Inbetriebnahme erfolgen kann – wenn überhaupt.
Denn möglicherweise rächen sich auch beim Schacht Konrad die Fehler bei der Atommüllentsorgung, die auch in Gorleben und der ASSE gemacht wurden. Ohne klare Kriterien und ohne jeden Alternativenvergleich wurde der Schacht Konrad einfach zum Endlager-Standort erklärt. Weil das alte Eisenerzbergwerk von der Salzgitter AG für den Erzabbau aufgegeben wurde, schlug man der Bundesregierung kurzerhand den Schacht als Atommüllhalde vor.
Gesagt – Getan. Über Sicherheitsbedenken der Landesbehörden setzte sich das Bundesumweltministerium per Weisung hinweg. Zahlreiche Probleme, auf die nicht nur die AG Schacht Konrad und andere AtomkraftgegnerInnen immer wieder hingewiesen hatten, wurden schließlich im rot-grünen Atomkonsens 2000/2 vom Tisch gewischt.
Damit die AKW-Betreiber dem schrittweisen Atomausstieg zustimmen, hatten rot-grüne Spitzenpolitiker kurzerhand die Genehmigung für den Schacht Konrad versprochen.
Schließlich sorgte das Bundesverfassungsgericht dafür, dass trotz aller Mängel mit dem unterirdischen Ausbau der alten Schachtanlage begonnen werden konnte. Das Gericht lehnte eine Prüfung z.B. der Langzeitsicherheit des Atommülllagers einfach ab, weil es keine Klageberechtigung in dieser Sache für den Kläger sah. Eine gerichtliche Überprüfung fand daher in dieser Sache gar nicht erst statt.
Auf der Seite der AG Schacht Konrad heißt es: „Die Fragen, die die Endlagerung radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung im Hinblick auf die Langzeitsicherheit aufwirft, betreffen der Sache nach erst in der (fernen) Zukunft aktuell werdende Szenarien, die keinen Bezug zu einer gegenwärtigen Betroffenheit des Beschwerdeführers in einem eigenen verfassungsbeschwerdefähigen Recht erkennen lassen.“ Damit bestätigt das BVerfG das skandalöse Urteil des OVG Lüneburg, es gäbe kein Recht auf Nachweltschutz. Die jetzige Generation wird von jeglicher Verantwortung für künftige Folgen ihres Tuns freigesprochen. Nicht einmal die Erkenntnis, dass die Zukunft sehr schnell kommen kann wie bei ASSE II und Morsleben, wurde auch nur ansatzweise berücksichtigt.
- AG Schacht Konrad: Zum Text der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Falle Traube
Atommüll-Problem 6: Niedrig radioaktiv belastete Stoffe (Freimessung)
Hinzu kommt weiterer Atommüll, der zwar nur sehr gering radioaktiv belastet ist und der deshalb aus Sicht der Atomwirtschaft und nach den geltenden gesetzlichen Regelungen nicht wie Atommüll behandelt werden muss. Verstrahlte Beton- und Stahlteile, die in enormen Mengen beim Rückbau anfallen, dürfen demnach „freigemessen“ werden, wenn sie unterhalb einer bestimmten Strahlung liegen. Da dies den Betreibern die hohen Kosten für eine reguläre Atommüll-Entsorgung erspart, werden diese Materialien „dekontaminiert“, bis sie die Grenzwerte unterschreiten. Diese Mengen dürfen dann weitgehend uneingeschränkt „verwertet“ werden, also in die normalen Stoffkreisläufe eingespeist werden. So findet dieser niedrig strahlende Müll Verwendung im Straßenbau (Beton) oder wird zu Bratpfannen verarbeitet. Im großen Stil gelangen die gering belasteten radioaktiven Abfälle also als „Wertstoffe“ großflächig in die Umwelt und tragen so zu einer Erhöhung der Grundbelastung bei.
Betreiber und Behörden beteuern immer wieder, dass diese Materialien „völlig harmlos“ seien und in keinem Fall gesundheitliche Risiken darstellen. Das aber wird von „kritischen“ Strahlenschützern bestritten: Jede zusätzliche radioaktive Belastung führe zu Gesundheitsrisiken. Grenzwerte, unterhalb derer Strahlung ohne Folgen bliebe, gibt es nicht. Vor allem die großräumige Verteilung und die enormen Mengen, die bei der Stilllegung von immer mehr Atomanlagen in die „normale“ Umwelt abgegeben werden, stellen deshalb ein Problem dar.
- AKWs stilllegen – Sehr schwachradioaktiver Müll – Hausmülldeponierung oder Endlagerung?
- AKWs stilllegen – Atommüllentsorgung auf der Hausmülldeponie
- Akut ist dieses Problem z.B. auch beim Rückbau des AKW Obrigheim, wo die dortigen Initiativen massiv auf mehr Sicherheit und Beteiligung beim Rückbau drängen: Rückbau Atomkraftwerk Obrigheim: Wie aus Atommüll normaler Müll wird
Trotz rechtlicher Bestimmungen, dass unterhalb eines Grenzwertes diese Baustoffe normal entsorgt werden dürfen, gibt es bereits heute immer mehr Probleme, die den AKW-Betreibern zu schaffen machen. So soll E.on z.B. diese „freigemessenen“ Abfälle nicht loswerden, weil sich Deponien schlicht weigern, diese Stoffe anzunehmen.
Darauf wies jüngst Vattenfall in einer für das Unternehmen typischen Art hin: Angesichts der Probleme bei E.on befürchtet Vattenfall beim Rückbau des AKW Brunsbüttel ähnliches und spricht angesichts der behaupteten völligen Harmlosigkeit der gering-kontaminierten Abriss-Materialien von „emotionalen Problemen“ bei Deponie-Betreibern und in der Bevölkerung.
Fazit: Diese ausgewählte Liste mit Atommüll-Problemen spielt bei dem vermeintlichen „Neustart“ für die Endlagersuche keine Rolle. Dabei zeigen alle diese Beispiele auf, dass nicht nur in der Vergangenheit massive politische Eingriffe zulasten von Sicherheit bei der Atommülllagerung erfolgten, sondern dass diese bis heute anhalten.
Und nicht zu vergessen: Mit keiner Silbe ist im Text oben davon die Rede, dass in Atomkraftwerken noch immer neuer hochradioaktiver Atommüll erzeugt wird. Und Standorte wie Gorleben, Ahaus, Morsleben und viele andere sind ebenfalls nicht einmal erwähnt…